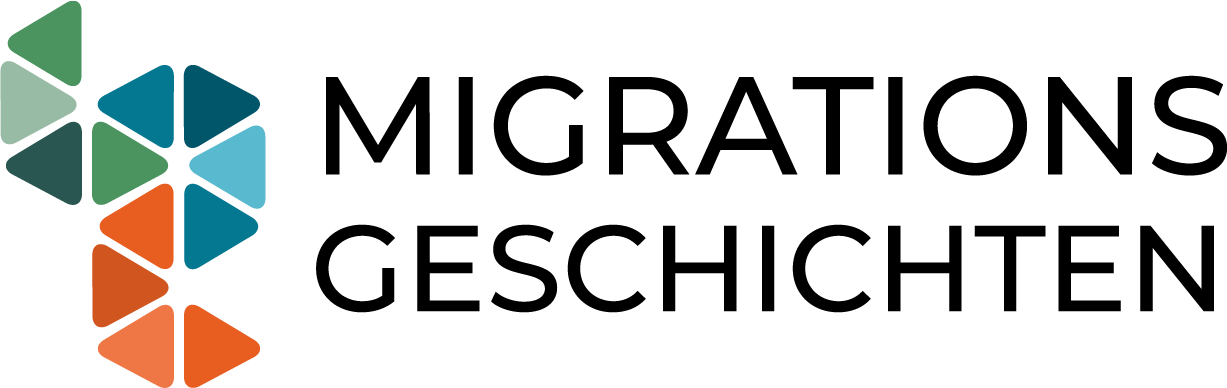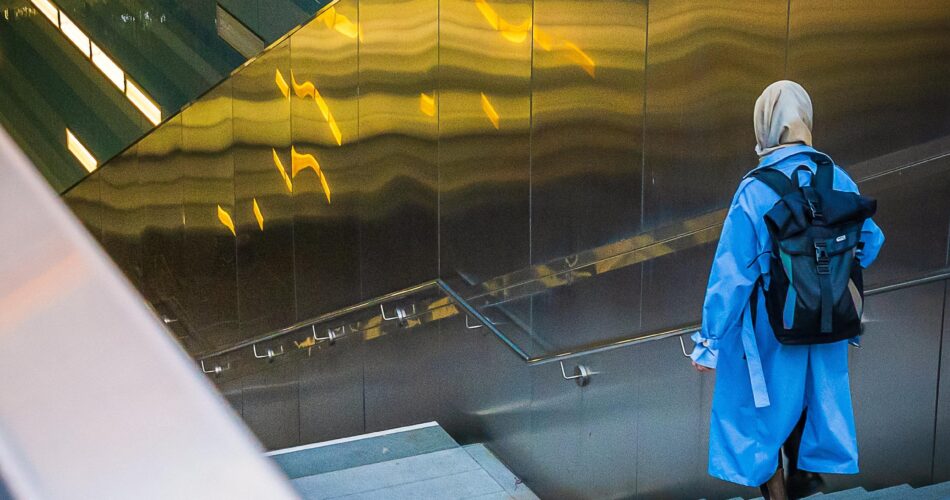Wir schreiben den 24.09.2003. Es ist der Tag des sogenannten Kopftuchurteils. Im Raum des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe liegt folgende Frage: Dürfen sich muslimische Lehrerinnen mit einem Kopftuch kleiden, wenn sie eine deutsche Schulklasse unterrichten – und vor allem – Wer darf darüber entscheiden?
Der Sachverhalt
Den Mittelpunkt des Gerichtsprozesses bildet eine Verfassungsklage der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin aus Baden-Württemberg. 1998 wurde ihr Einstellungsantrag als Beamtin in den Schuldienst vom Oberschulamt Stuttgart abgelehnt. Die Begründung: Eine mangelnde persönliche Eignung. Ihr Kopftuch gefährde nicht nur die staatliche Neutralitätspflicht an Schulen, sondern auch das Bild der Geschlechtergleichstellung in Deutschland, welches den Schüler*inne*n vermittelt werden solle.
Geboren ist die junge Lehrerin in Afghanistan, aufgewachsen in Saudi-Arabien. Seit ihrer Einwanderung nach Deutschland sind zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Jahre vergangen. Deutsche Staatsbürgerin ist sie seit acht Jahren. Auch ein erfolgreiches Lehramtsstudium in den Fächern Englisch, Deutsch und Gemeinschaftskunde liegen zurück. Fereshta Ludin hat ohne Zweifel einen beachtlichen Weg der Integration in die deutsche Gesellschaft vollbracht, ihr Kopftuch solle jedoch ein Teil ihrer religiösen Identität bleiben. „Ich trage es nicht nur in der Schule, sondern allgemein in der Öffentlichkeit.“, verkündet sie am 24.09.2003 entschieden vor Gericht. [Quelle: Deutschlandfunk, 02.04.2015]
Der Prozess
Fereshta Ludin akzeptierte die Ablehnung ihres Einstellungsantrags nicht und klagte sich fünf Jahre lang durch alle Instanzen. In einem FAZ-Beitrag erklärt sie später ihre Sicht:
„Wäre das Kopftuch ein Zeichen von Unterdrückung, ich wäre die Erste, die es absetzt. Mir ist wichtig, dass jede Frau ihren persönlichen Weg findet – ob mit oder ohne Kopftuch.“
Fereshta Ludin: Niemand wird durch das Kopftuch islamistisch. In: FAZ 07.05.2015
Die kulturpolitisch-geprägte Mehrdeutigkeit der religiösen Kopfbedeckung lenkt den Gerichtsprozess in den Zwiespalt. So sei ein allgemeines Kopftuchverbot für Lehrerinnen an Schulen ein Bruch des Grundrechts der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2). Der Zugang zu öffentlichen Ämtern dürfe zudem nicht durch das religiöse Bekenntnis deutscher Bürger*innen beeinflusst werden. Dennoch gelte es sicherzustellen, dass das Kopftuch im Unterricht nicht dazu führe, dass es den staatlichen Erziehungsauftrag in religiöse oder weltanschauliche Richtungen lenke, heißt es im Pressebericht des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.09.2003.
Lehrer*innen haben eine Vorbildfunktion. Während des Unterrichts stehen sie im Mittelpunkt des Geschehens. Dass das Kopftuch dabei bewusst oder unbewusst eine Wirkung auf die Schulkinder nimmt, steht außer Frage. Wohl lässt sich hingegen infrage stellen, ob diese Wirkung nun ausschließlich negativ zu bewerten sei. Klar ist, dass sich ein solcher Sachverhalt schwer generalisieren lässt. Zu diesem Urteil kommt auch das Bundesverfassungsgericht:
Der Rechtsspruch
„Der mit zunehmender religiöser Pluralität verbundene gesellschaftliche Wandel kann Anlass sein, das zulässige Ausmaß religiöser Bezüge in der Schule neu zu bestimmen.“
„Lehrerin mit Kopftuch“. Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes Nr. 71/2003 vom 24. September 2003 zum Urteil vom 24. September 2003
Die Gesetzeslage ist unscharf, die tatsächliche Gefahrenlage sehr abstrakt. So hebt das Bundesverfassungsgericht das Urteil gegen Fereshta Ludin am 24.09.2003 auf und überlässt die Ausführung der fehlenden Gesetzesgrundlage den Landesgesetzgebern selbst. Jedes Bundesland dürfe im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgabe das zulässige Maß religiöser Bezüge in der Schule neu bestimmen.
Das Bundesland Baden-Württemberg macht den Anfang und bleibt bei seinem Entschluss, das Tragen eines Kopftuchs für Lehrerinnen an staatlichen Schulen ausnahmslos zu verbieten. Durch das Urteil fühlen sich viele weitere Bundesländer dazu animiert, sich mit ähnlichen Gesetzesentwürfen anzuschließen. Dazu zählen Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie das Saarland.
Doch wie sieht es eigentlich mit einem christlichen Kreuz oder einer jüdischen Kippa aus? Das Kopftuchverbot stößt an die Grenzen des Gleichbehandlungsgebotes von Religionen. 2005 reagiert die Bundeshauptstadt Berlin deshalb mit einem Dekret, welches sämtliche sichtbare religiöse Symbole für alle Staatsdiener*innen untersagt.
Im Zweifel für die Freiheit – Ein neues „Kopftuchurteil“
Der Diskurs um die Auslegung eines verfassungskonformen und zeitgemäßen Neutralitätsgebotes hat mit dem Urteil von 2003 noch lange kein Ende genommen. Am 27.01.2015 brachte eine ähnliche Anklage zweier Lehrerinnen aus NRW das Bundesverfassungsgericht erneut in die Verhandlung. Der Beschluss von 2003 wurde als verfassungswidrig erklärt und entsprechend angepasst. [Siehe „Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte in öffentlichen Schulen ist mit der Verfassung nicht vereinbar“. Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes Nr. 14/2015 vom 13. März 2015 zum Beschluss vom 27. Januar 2015]
In Deutschland gilt seitdem folgende Regelung: Auch die Länder selbst dürfen kein pauschal gültiges Kopftuchverbot mehr für Lehrerinnen erheben. Nur wenn der Schulfrieden eindeutig bedroht sei, ließe es sich im Einzelfall verbieten. Christliche Werte dürften im öffentlichen Dienst nicht privilegiert werden. Die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit müsse geschützt bleiben, solange aus ihr keine eindeutige Gefahr für das Volk entstünde.
Von der Theorie und Praxis
Insbesondere Berlin tat sich mit der praktischen Umsetzung dieses Urteils schwer. Wie ließe sich eine solche Gefährdung konkret messen? Erst seit Beginn des neuen Schuljahres 2023/24 dürfen in der Hauptstadt nun auch Lehrerinnen mit Kopftuch vor ihre Klassen treten.
Kommunikation anstatt Stigmatisierung
Das neue Urteil führt zu neuen Hürden. Heute trägt die Schulleitung die alleinige Verantwortung dafür, zu entscheiden und zu begründen, wann der Schulfrieden durch eine kopftuchtragende Lehrerin eindeutig gestört sei. Je nach Region, Schülerschaft, den Ansichten der Eltern und dem Klima im Kollegium ist dies eine Aufgabe, die großes Konfliktpotential mit sich tragen kann. Gleichwohl wachsen auch die Chancen, den Schulkindern Werte wie Toleranz und Offenheit zu vermitteln. Vorurteile können abgebaut werden, bevor sie sich verfestigen und die Integration von jungen Muslim*inn*en findet einen neuen Anklang.
Ein Blick über die Landesgrenze hinweg – Neuigkeiten aus Frankreich
Auch andere Länder der EU sehen sich regelmäßig mit dem Streit um das Tragen des Kopftuches konfrontiert. Während in Deutschland die Regelungen zunehmend gelockert werden, greift Frankreich auf striktere Maßnahmen zurück. Ein generelles Kopftuchverbot an Bildungsstätten gilt dort seit 2004 – Und zwar für Lehrerinnen UND für Schülerinnen. Kippa und Kreuz gelten hingegen weiterhin als erlaubt.
Am 27.08.2023 verkündete der französische Bildungsminister Gabriel Attal im Sender TF1, dass nun zusätzlich das Tragen von langen Überkleidern, den Abayas, an Schulen untersagt werden solle. Damit werde der Regierung zur Folge die klare Trennung zwischen Staat und Kirche gesichert – Ein übergeordneter Wert in der französischen Nation.
Ein Wertekonflikt
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist im sogenannten Kopftuchstreit auch in Deutschland noch nicht das letzte Urteil gefallen. In einer offenen Gesellschaft im Wandel sind Kompromisse zeitweilig, doch der Konflikt bleibt beständig. Es gilt immer wieder unser Handeln und Wirken, mit den Werten unseres Grundgesetztes abzugleichen.

Titelbild: Michoff auf Pixabay, gemeinfrei