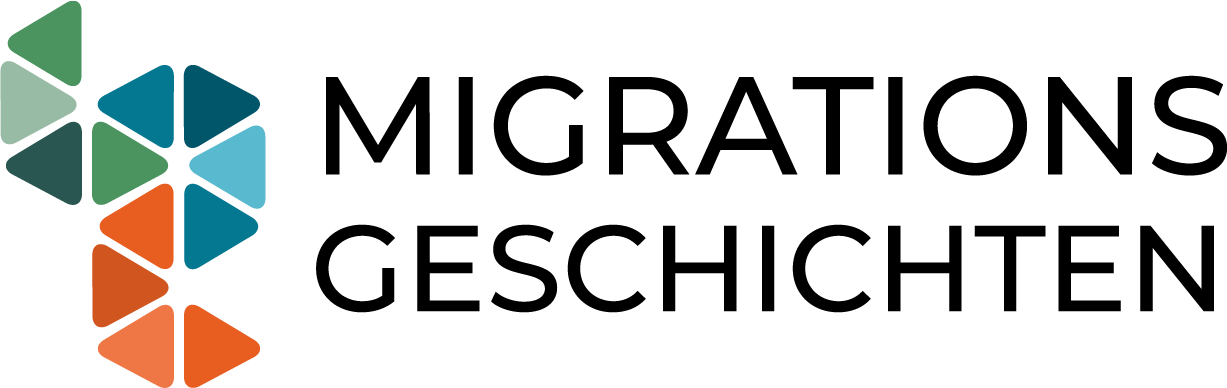Kolonialismus und (Im-)Migration sind zwei verschiedene Themen. Zumindest werden sie oft getrennt voneinander behandelt. Dass sich mit dem europäischen Kolonialismus aber nicht nur weiße Europäer:innen in anderen Teilen der Welt niederließen, sondern auch umgekehrt, kommt selten zur Sprache. Als Sklav:innen und auf freiwilliger Basis erreichten Menschen aus den besetzten Gebieten das Deutsche Reich sowie später die Weimarer Republik. Viele kamen nur für kurze Zeit, andere blieben.
Eine aktuelle Sonderausstellung der Kultur-Netzwerkes Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt und des FHXB in Berlin-Kreuzberg versucht die Geschichte all dieser Menschen sichtbar zu machen. Darin erhalten Besucher:innen Einblicke in das alltägliche Leben Berliner Migrant:innen und ihrer Nachkommen, die Bedingungen ihrer Einwanderung und den anhaltenden Kampf um Gleichberechtigung. TROTZ ALLEM: Migration in die Kolonial-Metropole Berlin wurde am 21. Oktober 2022 eröffnet und kann noch bis zum 30. April dieses Jahres besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.
Alles ist vernetzt
Was die Besucher:innen erwartet ist eine kleine, sachlich gestaltete Ausstellung mit schlichten, schwarzen Stellwänden. Hellbraune Holzstreben verbinden alle Bestandteile im Raum miteinander. Aber auch ohne diese optische Betonung fallen in der Ausstellung die vielen thematischen Querverweise ins Auge. Sie zeigen Zusammenhänge zwischen der Außenpolitik des Deutschen Reiches und den unsteten, oft unklaren Gesetzmäßigkeiten gegenüber Immigrant:innen. Was diese wiederum für das Leben einzelner Menschen bedeuteten, erfahren wir über sechs ausgewählte Familienbiografien.
Exotisierende Unterhaltungsindustrie
Da ist zunächst die Familie Soliman. Der aus Ägypten stammende Mohammed Soliman leitet während der 1920er Jahre in Berlin ein Café und mehrere Lichtspielhäuser. In der Unterhaltungsbranche ist er zu diesem Zeitpunkt schon über zwei Jahrzehnte tätig. Bis er sich 1900 in Berlin niederlässt tourt Mohammed in einer Gruppe von Unterhaltungskünstler:innen durch halb Europa. Die Shows sind gefragt. Dabei muss ihr Auftritt in der Regel den stereotypen Vorstellungen des weißen Publikums vom „exotischen Orient“ entsprechen.
Auch das Schicksal der miteinander befreundeten Familien Boholle, Garber und Egiomuew ist eng mit der Unterhaltungsindustrie verbunden; jedoch mehr unter Zwang als freiwillig. Ende des 19. Jahrhunderts gelangen drei zukünftige Familienväter aus dem heutigen Togo und Kamerun über die erste deutsche Kolonialausstellung nach Berlin. Ihre Familien gehören zu der Oberschicht des jeweiligen Landes. Hier müssen sie jedoch in primitiver, vermeintlich authentischer Kleidung auftreten und sich dem Publikum als „Wilde“ präsentieren.
Afrodeutsches Familienleben bis 1945
Nach dieser entwürdigenden Darstellung beginnen die drei Männer eine Ausbildung, heiraten weiße deutsche Frauen und bleiben bis zu ihrem Lebensende in Berlin. Das ist zu dieser Zeit vom Staat jedoch nicht vorgesehen. Unklare Gesetze, die ständige Gefahr ohne einen deutschen Pass abgeschoben zu werden, prägen das Leben der Garbers, Egiomuews und Boholles über Jahrzehnte.
So schweißen unterschiedliche diskriminierende Erfahrungen die Familien zusammen. In diesem Sinne verstehen sie sich als „Landsleute“, auch wenn die erste Generation in Deutschland aus unterschiedlichen Ländern stammte. Zur Zeit des Nationalsozialismus müssen die Familien erneut als „Ausstellungsobjekte“ durch Deutschland und darüber hinaus touren. Damit bewerben sie unmittelbar die neuen, deutschen Kolonialpläne. Nur diese Arbeit kann sie für kurze Zeit vor der Verfolgung schützen. In den letzten Kriegsjahren müssen sie dennoch aus Deutschland fliehen oder werden in KZs verschleppt.
Aus anderen „kolonialen Kontexten“
Anders als die befreundeten afrodeutschen Familien Boholle, Egiomuew und Garber stammen die anderen drei Familien in der Ausstellung nicht aus den deutschen Kolonien in Afrika. Ihre Herkunftsorte sind China und Ägypten. Abgesehen von einer kleinen deutschen Kolonie an der Küste Chinas ab 1898 standen beide Länder ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem unter britischer Kontrolle. Dennoch bildeten Kolonialismus und Imperialismus den Hintergrund für vielfältige Migrationsbewegungen zwischen diesen Reichen und Deutschland. Darum nimmt die Ausstellung nicht „nur“ Menschen aus deutschen Kolonien in den Blick, sondern auch andere, die „aus kolonialen Kontexten“ nach Deutschland immigrierten. Warum und wie sie dies taten, erzählen die Biografien der Familien Taen, Xie und Soliman.
„Freundschaften“ durch imperialistische Konkurrenz
Dass Mohammed Soliman in Berlin erfolgreich ein, später mehrere Stummfilmkinos leitete, wurde bereits berichtet. Aber wie kam es dazu, dass er sich nach seiner Europa-Tour in Berlin niederlassen konnte? Soliman erreichte Deutschland als junger Ägypter. Das Land gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zum Osmanischen Reich und stand damit unter britischer Besatzung. Als politischer Gegner des britischen Königreiches, bot die deutsche Regierung dem Osmanischen Reich seine militärische Unterstützung an.
Außerdem knüpfte die Regierung gezielt einzelne Kontakte zu nationalistischen Gruppierungen und Personen, die den britischen Besatzern feindlich gegenüberstanden. Zum politischen und kulturellen Austausch wurden sie daraufhin eingeladen, das Deutsche Reich zu besuchen. Dort konnten sie unter anderem eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Diese diplomatische Nähe begünstigte schließlich auch eine wachsende, osmanisch geprägte Unterhaltungsindustrie im Deutschen Reich, die Künstler:innen und Unternehmern wie Soliman eine Lebensgrundlage bot.
Ähnliche Beziehungen wie zum Osmanischen Reich pflegte das Deutsche Reich mit weiteren, besetzten oder kontrollierten Länder; darunter Indien und China. Mit dieser Politik ermöglichte die deutsche Regierung den Bildungsaufenthalt einzelner Migrant:innen aus wohlhabenden Verhältnissen im Deutschen Reich – ohne damit die dauerhafte Niederlassung erleichtern zu wollen. Wer sich trotzdem zum Bleiben entschloss hatte dementsprechend mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen wie andere Minderheiten mit Migrationsgeschichte. Dieser Umstand motivierte wiederum Angehörige unterschiedlicher Gruppierungen aktiven, politischen Widerstand zu leisten.
Deutsch-chinesische Lebenswege und Beziehungen
Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück zu den Bedingungen des deutsch-chinesischen Austausches. Dazu lohnt ein Blick auf das Schicksal der Familie Taen: Im Zuge des zweiten Opiumkrieges zwischen den Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich und dem chinesischen Kaiserreich musste der spätere Familienvater Taen seinen derzeitigen Lebensstandort in England verlassen. Sein Weg führte ihn ins Deutsche Reich, wo er sich bald als Kaufmann etablieren konnte.
Zu dieser Zeit entstand in Deutschland bereits eine kleine chinesische Community. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts pflegte das chinesische Kaiserreich mit dem zunächst Kolonielosen Deutschen Reich eine Handelsbeziehung. Jungen Chinesinnen und Chinesen aus höheren Gesellschaftsschichten verschaffte dieses Verhältnis eben jene Möglichkeit im Deutschen Reich zu studieren. Die Beziehung zwischen beiden Ländern war jedoch keineswegs auf Augenhöhe ausgerichtet, wie es der von deutscher Seite aufgedrängte Handelsvertrag suggerierte.
Selbst als die einseitige Ausbeutung des chinesischen Königreiches unter anderem durch Deutschland um 1900 drastisch zu Tage trat und sich das zwischenstaatliche Verhältnis öffentlich abkühlte, hörte die chinesische Präsenz in Deutschland nicht einfach auf. Beispielsweise setzte sich der „Club chinesischer Studenten“ ab 1902 weiter für die Rechte immigrierter Chines:innen ein. Auch in der Weimarer Republik vernetzten sich Menschen in unterschiedlichen migrantischen Communities. Zum Teil schlossen sie sich auch deutschen Parteien an, die für die Rechte von Minderheiten und gegen eine neue deutsche Kolonialpolitik einstanden. Ein Beispiel zeigt das Engagement der Paares Xie und Cheng in Berlin. Bis zur Flucht beziehungsweise bis zur Ausweisung im Nationalsozialismus engagierten sich beide Eltern des kleinen Han Sen in der KPD.
Ein unsicherer Status
Neben aller Unterschiede zeigen die Geschichten dieser sechs Familien wiederkehrende Muster und Gemeinsamkeiten auf. Auch ohne politische Vertretung scheint ihr Leben in Deutschland stets politisch gewesen zu sein: Außenpolitische Strategien des Reiches, innenpolitische Parteienkämpfe und gesamtgesellschaftliche Zäsuren wie der Erste und Zweite Weltkrieg bestimmten ihren Status. Ausgesetzt waren sie allen politischen Schwankungen vor allem über den unklaren Rechtsstatus. Migrant:innen, ihre Ehepartnerinnen und Nachfahren aus deutschen Kolonien verfügten bis 1919 zwar über einen Ausweis als „Angehörige deutscher Schutzgebiete„. Mit dieser stark beschönigenden Bezeichnung blieben ihnen jedoch sämtliche Rechte verwehrt.
Anders als ihre deutschen Mitmenschen verfügten Menschen mit Migrationsgeschichte und ihre weißen Ehepartnerinnen über keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ohne diese konnten sie jederzeit ausgewiesen werden. Im Deutschen Reich und der Weimarer Republik war Einwanderung ohne „Rückkehr“ nicht vorgesehen. Auch wenn das Gesetz Anträge zur Einbürgerung für Angehörige deutscher Kolonien grundsätzlich in Aussicht stellte, erreichten diese nur in seltenen Fällen ihr Ziel. Wer, wann und aus welchen Gründen ins vermeintliche „Herkunftsland“ „zurückgeschickt“ wurde, war für die Betroffenen weder vorhersehbar noch steuerbar.
Trotz allem – privates und politisches Leben
Bis heute spiegelt sich diese politische Willkür sowie rassistische Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund über Generationen hinweg in staatlichen Dokumenten, Zeitungsartikeln und amtlichen Schreiben wider. Das Problem hinter dieser Quellenauswahl bleibt der eingeschränkte Blickwinkel. Wir nähern uns der Geschichte der betroffenen Menschen mit prekärem gesellschaftlichem Status durch die oftmals rassistische Brille der dominierenden Mehrheitsgesellschaft. Schlimmstenfalls führt das dazu, dass sich diskriminierende Stereotype noch über Jahrhunderte hinweg aufrecht erhalten. Daneben fehlen uns Einblicke aus der Innenperspektive.
TROTZ ALLEM versucht diesem Effekt gegenzusteuern. Neben vielen Textdokumenten präsentiert die Ausstellung eine beachtliche Anzahl an historischen Fotografien, meist aus dem Privatbesitz der Familien. Sie zeigen die porträtierten Personen im Kreis ihrer Freunde, fröhlich und selbstbewusst am Strand, als Mitglieder der örtlichen, freiwilligen Feuerwehr, vor dem eigenen Kino und vieles mehr. Zusätzlich verweisen Karten mit gesammelten Daten und Fakten auf das politische Engagement migrantischer Communities oder Einzelpersonen. Da das Schicksal von sechs Familien nicht jede Form des Widerstandes aufzeigen kann, enthält die Ausstellung außerdem kleine Exkurse zu Meilensteinen migrantischer Selbsthilfe – von Martin Dibobes Petition bis hin zu Schwarzen deutschen Initiativen der 1980er Jahre.
Sensibilisieren, Aufklären, Aufbrechen…
…will die Ausstellung TROTZ ALLEM: Nicht nur durch die thematische Vielfalt und neue Blickwinkel werden bestehende historische Bilder von Migration und Migrationsgeschichte in Deutschland demontiert. Auch gestalterisch und textlich fordert die Ausstellung den Besucher:innen einiges ab. Ein lohnender Mehraufwand, wie ich finde: Kleine Striche mitten durchs Wort kennzeichnen historische, rassistische Begriffe. Solche Wörter weiterzuverwenden und zu zeigen, birgt immer die Gefahr, rassistische Stereotype unhinterfragt zu reproduzieren. Eine Lösung wäre, sie komplett zu wegzulassen. Die Macher:innen von TROTZ ALLEM greifen auf eine andere Lösung zurück.
Bis auf wenige Ausnahmen finden sich sämtliche problematische Ausdrücke sowohl in Quellentexten selbst als auch in Ausstellungstexten wieder. Durch die Markierungen sind sie jedoch schwerer lesbar als der übrige Text. Kleine Fußnoten erläutern dazu die Problematik des jeweiligen Begriffs, der teilweise noch heute im Deutschen geläufig ist. Es ist ein kleiner Taschenspielertrick, womit rassistische Sprach- und Denkmuster beleuchtet und hinterfragt werden sollen. Zusätzlich dazu konfrontieren schwarze Schriftbanner die Besucher:innen mit Fragen, die bis heute gültig sind. Zum Beispiel: „Dürfen alle Berlin mitgestalten? Wer tut es trotz allem?“ Im darunterliegenden Ausstellungsabschnitt werden die meisten Fragen in der Geschichte beantwortet. Wie die Antwort für heute und für die Zukunft ausfallen könnte, müssen wir selbst herausfinden.
Titelfoto: Ausstellungsflyer, fotografiert vor dem Eingang des Museumsgebäudes, eigenes Foto.