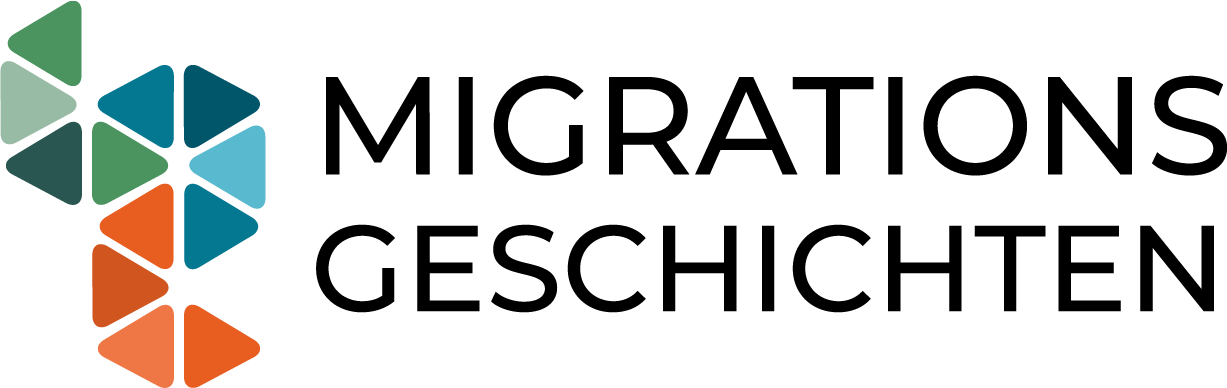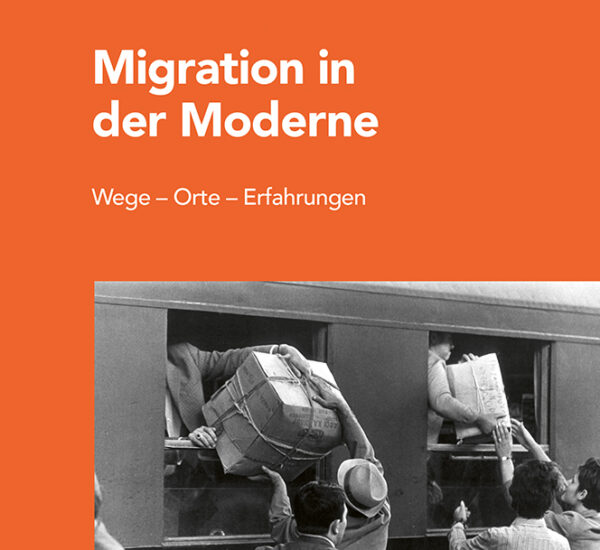Können Sie sich ein Leben ohne Pass vorstellen? Gibt Ihnen Ihr Ausweis ein Gefühl von Zugehörigkeit? Im Sommer 2022 machten sich Mitarbeiter:innen des Deutschen Historischen Museums (DHM) auf den Weg und befragten Passanti:nnen in Berlin nach ihren Gedanken und Gefühlen zum Thema Staatsbürgerschaften. So vielfältig wie die Menschen waren ihre Antworten. Manchen kommt ihr Pass vor wie eine Selbstverständlichkeit, ebenso ihre Staatsbürgerschaft. Andere müssen sich hingegen tagtäglich ausweisen und für ihre Anerkennung als Staatsbürger:innen Deutschlands kämpfen.
Was Staatsbürgerschaften und damit der Pass eines Menschen alles bedeuten können, zeigt derzeit eine Sonderausstellung im DHM in Berlin. Von Juli 2022 bis zum 15. Januar 2023 werden hier verschiedene Facetten des Phänomens Staatsbürgerschaft in Frankreich, Deutschland und Polen beleuchtet. Wie wandelbar und standortabhängig die Bedingungen für den Erhalt einer Staatsbürgerschaft allgemein sind, verdeutlicht die Ausstellung mit einem Blick in die Geschichte der drei Länder von 1789 bis heute.

Polen, Frankreich, Deutschland – (k)ein Ländervergleich
Seit 1990 verbindet Bürger:innen aus unterschiedlichen Ländern der Europäischen Union die gemeinsame Unionsbürgerschaft. Heute bedeutet das, dass beispielsweise Menschen mit französischer Staatsbürgerschaft ohne großen Aufwand in Deutschland oder Polen arbeiten und leben können. Eine Einbürgerung ins entsprechende EU-Land ist für sie in der Regel nicht notwendig. Aber schon vor dieser Regelung gab es zwischen den drei europäischen Ländern einen regen Austausch. Neben Menschen überquerten über die Jahrhunderte hinweg auch Waren und vor allem Ideen die Landesgrenzen. So ist es nicht verwunderlich, dass in den Staaten einige Parallelen bezüglich der jeweiligen Staatsbürgerschaften und Einbürgerungsgesetze zu finden sind:
Bis heute wird die Staatsbürgerschaft in Deutschland, Polen und Frankreich größtenteils nach dem Prinzip der Abstammung und des Geburtsortes vergeben. Für eine Einbürgerung spielen darüber hinaus Sprach- und Kenntnisse über den jeweiligen Staat, die eigene Aufenthaltsdauer oder die der Eltern eine entscheidende Rolle. Wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, muss heute zudem einen sogenannten Einbürgerungstest bestehen. In Polen richten die Antragsteller:innen ein Motivationsschreiben an den Präsidenten. Das französische Gesetz setzt wiederum ein Aufnahmegespräch voraus.
Staatsbürgerschaften als politisches Druckmittel
Staatsbürgerschaften regeln die „Verteilung von Lebens- und Überlebenschancen“ innerhalb politisch gezogener Grenzen eines Landes. Sie zu entziehen oder zu verwehren bedeutet für die Betroffenen demnach ein drastischer Verlust an Rechten und Regelungen zu ihrem eigenen Schutz. Beispiele für diesen plötzlichen Verlust als Folge von politischen Konflikten gibt es in der Geschichte genug.
Hierzu zählt die Lage der elsässischen und lothringischen Bevölkerung nach der französischen Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870 bis 1871. Nur wer bereitwillig auf die französische Staatsbürgerschaft verzichtete, durfte in den von Deutschland besetzten Gebieten Elsass und Lothringen bleiben. Ansonsten drohte die Abschiebung. Etwa 10 Prozent der elsässischen Bevölkerung verließ in Folge dieser Anordnung ihre Heimat. 1918 folgte dann die sprichwörtliche „Retourkutsche“: Im Ersten Weltkrieg gehörte das Deutsche Reich zu den Besiegten. Alle Bewohner:innen ohne nachweislicher „französischer Abstammung“ mussten die Regionen Elsass und Lothringen verlassen. Die formale Zugehörigkeit, die ihnen ihr bisheriger Pass zusicherte, wurde damit aufgehoben.
Staatsbürgerschaften erkämpfen
Unabhängig von solchen zwischenstaatlichen Konflikten gibt es innerhalb vieler Gesellschaften Bevölkerungsteile denen eine Staatsbürgerschaft grundsätzlich verwehrt bleibt. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um Minderheiten. Als ein Beispiel steht in der Ausstellung „Staatsbürgerschaften“ auch die Geschichte der rechtlichen Ungleichstellung von Männern und Frauen im Zusammenhang mit Staatsbürgerschaftsgesetzen im Fokus.
Zwar gilt es heute in Polen, Frankreich und Deutschland als selbstverständlich, dass Frauen ihre eigenständige Staatsbürgerschaft und damit beispielsweise das Wahlrecht „besitzen“, diese Regelung etablierte sich in allen drei Ländern allerdings erst Mitte des letzten Jahrhunderts. Bis dahin blieb der Rechtsstatus der meisten französischen, polnischen und deutschen Frauen an die Staatsbürgerschaft ihres Mannes gekoppelt. Erst durch das Engagement mutiger Frauen wie Olympe de Gouges im 18. Jahrhundert, Louise Otto-Peters oder Paulina Kuczalska-Reinschmit im 19. und 20. Jahrhundert konnte sich in Polen, Deutschland und Frankreich die selbständige Stellung der Frau als wahlberechtigte Staatsbürgerin durchsetzen.



„Landsleute“ ohne Staatsbürgerschaft?
Als nicht vollwertige Staatsbürger:innen wurden indes auch Jüdinnen und Juden oder Indigene in deutschen und französischen Kolonien angesehen. Obwohl Teile der indigenen Bevölkerung sowie Juden im 19. und 20. Jahrhundert im Militär gemeinsam mit ihren christlichen, europäischen Mitmenschen kämpften, waren sie wiederholt diskriminierenden Maßnahmen ausgesetzt. Dies schloss in manchen Fällen, wie der antisemitischen Kampagne in Polen 1967, auch den vollständigen Entzug der Staatsbürgerschaft und die Ausweisung jüdischer Mitbürger:innen ein.
Der indigenen Bevölkerung in deutschen und französischen Kolonien blieb bis zur Dekolonisierung der entsprechenden Gebiete die Staatsbürgerschaft der Kolonialmacht grundsätzlich verwehrt. Sogenannte „Mischehen“ zwischen Indigenen und weißen Europäer:innen stellten eine selten tolerierte Ausnahme dar. Auch die Strafgesetze für die indigene Bevölkerung waren ungleich härter als die der weißen, anerkannten Staatsbürger. Die zahlreichen Formen ihrer Unterdrückung standen dabei oft im Gegensatz zu beschönigenden Darstellungen der Kolonialmacht. Deutlich wird in der Ausstellung der paradoxe Umgang mit der indigenen Bevölkerung von Seiten der Kolonialherren anhand ausgewählter Exponate wie dem Werbeflyer einer sogenannten „Völkerschau“ über Samoa im Jahr 1900. Während Kolonialausstellungen Indigene und ihre Kultur anhand populärer Stereotype, unter oftmals menschenunwürdigen Bedingungen wie Zootiere inszenierten, suggerierte der Ausstellungstitel „Unsere neuen Landsleute“ doch einen vermeintlich respektvollen Umgang auf Augenhöhe.

Ein Blick in die Gegenwart
Diskriminierung und eingeschränkte Rechte sind bis heute weit verbreitete Phänomene, die nicht allein an den Pass eines Menschen gekoppelt sind. Dennoch zeigt die Ausstellung „Staatsbürgerschaften“ des DHM wie eng die Frage nach Zugehörigkeit und Ausgrenzung innerhalb eines Staates mit dem Erhalt beziehungsweise der Vergabe von Staatsbürgerschaften zusammenhängt. Neben der historischen Perspektive wirft die Ausstellung weiterhin einen Blick auf aktuelle Entwicklungen:
Wer hat einen Anspruch auf die deutsche, polnische, französische Staatsbürgerschaft? Und welche Rechte und Pflichten sollten vielleicht auch denjenigen zustehen, die an ihrem dauerhaften Wohnort keine Staatsbürgerschaft erhalten? Manche Fragen rund um das Thema Staatsbürgerschaft bleiben über die Jahrhunderte hinweg aktuell. Dabei drehen sich heutige Debatten oft um Anerkennung oder Abwehr, sowie um die Konsequenzen von Migrationsbewegungen über die Grenzen der EU hinweg. Zu einer internationalen, einheitlichen Lösung kommt es dabei nicht immer. Ein Beispiel sind die bis heute anhaltenden Diskussionen um die doppelte Staatsangehörigkeit. Auch nach ihrer Zulassung im Jahr 2014 wird sie in Deutschland immer wieder kritisiert. Demnach stellt gerade für Menschen mit einer eigenen Migrationsgeschichte die staatliche anerkannte Zugehörigkeit in dem Land, in dem sie leben, meist keine Selbstverständlichkeit dar. Dahingegen werden gerade die Nicht-Betroffenen – das heißt Menschen, die nicht um ihre Staatsbürgerschaft fürchten oder kämpfen müssen – in der aktuellen Ausstellung des DHM zum Nachdenken angeregt.
Titelbild: Ausstellungsflyer und Plakat der Ausstellung "Staatsbürgerschaften - Frankreich, Polen, Deutschland seit 1789", eigenes Foto.