Migration verändert

Nguyen Tien Duc während des Krieges als Matrose mit seinem Bruder. Foto: privat
Nach dem Krieg in Vietnam, in dem er als Matrose diente, kam Nguyen Tien Duc 1977 voller Elan in die DDR, um eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur zu absolvieren. Im Krieg musste er nie direkt an die Front, aber viele seiner Freunde sind dort gestorben oder wurden verletzt. Seit kurzem im Ruhestand, beschäftigt er sich auch mit der Frage, wie ihn die Migration verändert hat. Die Bilanz: Etliches ist anders, aber vieles hat er auch beibehalten.
Das Wichtigste: Er behielt eine gewisse Bedächtigkeit bei. Er kann blitzschnelle Perspektivenwechsel vollziehen, sich in sein Gegenüber einfühlen und versucht, seine Worte so zu wählen, dass seine Gesprächspartner, auch wenn er sie in der Sache hart kritisiert, nicht ihr Gesicht verlieren. Freundlichkeit als atmosphärische Grundlage jedes Gespräches, die er aus der vietnamesischen Kultur mitgebracht hat, ist ihm wichtig. Und er hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Das Beste aus beiden Welten zu vereinen ist sein Ziel. In mehreren Sprachen und Kulturen zu Hause zu sein, ist für Duc ein großer Vorteil. Er kann Brücken bauen und erkennt Missverständnisse sehr schnell – um sie dann aus dem Weg zu räumen. Auf seinen Akzent ist Duc stolz, er gibt seinem Deutsch eine besondere Note. Die mentale Flexibilität durch zwei Kulturen sorgt dafür, dass er immer eine Idee mehr hat, immer einen Aspekt mehr sieht, eine Perspektive einbringt, die neu ist. Einige Dinge behielt er aber bei: jeden Tag isst er Reis, im Vietnamesischen spricht er immer noch den Dialekt seiner Heimatstadt.
„Ich begann, Fragen zu stellen“
Zu DDR-Zeiten hat Nguyen Tien Duc zu allem ja gesagt. Er wurde in Vietnam im „sozialistischen“ Geist erzogen und war 1977 mit der Idee in die DDR gekommen, dass die DDR-Bürger*innen in Sachen sozialistisches Bewusstsein viel weiter seien als die Vietnames*innen und man daher von ihnen in jeder Hinsicht lernen könne. Er hatte auch gelernt, dass die DDR-Bürger*innen sich durch eine besondere Ehrlichkeit auszeichnen sollten. Wenn er etwas nicht verstand oder kritisch sah, nickte er nur. Was seine Vorgesetzten sagten, war der Maßstab der Dinge. Nach und nach ergaben seine Kontakte mit den DDR-Bürger*innen ein anderes Bild. Er bemerkte, dass nicht alles so rosig war, wie er es vermittelt bekam. Die Leute waren nicht gut auf die Vietnames*innen zu sprechen, weil die ihnen „alles wegkauften“. Viele waren unzufrieden und mürrisch. Irgendwas stimmte nicht. Die Vietnames*innen waren viel selbstloser, engagierter; bereit sich aufzuopfern und die Sache über ihre Person zu stellen. Sie waren Mangel und Entbehrung gewöhnt und klagten wenig. Sie hatten einen Krieg hinter sich, den Leuten in der DDR ging es materiell verhältnismäßig gut. Als er sah, dass der „Sozialismus“ in der DDR Menschen, die „Westgeld“ hatte, Privilegien einräumte, brach das Bild vom weit entwickelten Sozialismus endgültig zusammen.
Warum, so fragte er sich, bin ich auf diese Manipulation reingefallen? Und er beschloss, von nun an immer Fragen zu stellen. Er wurde unbequem. Anfangs war es eine große Überwindung, den Mund aufzumachen. In der Rückschau ist er daran gewachsen. Kritisches Argumentieren macht ihm Freude; die Rolle dessen, der immer eine Frage mehr stellt als die anderen, gefällt ihm.

Nguyen Tien Duc 1977 kurz vor der Ausreise in die DDR. Foto: privat 
Nguyen Tien Duc (links) angekommen in der DDR. Foto: privat
„Ich könnte auch sehr, sehr traurig sein, nach allem, was mir so passiert ist. Aber ich habe mich dafür entschieden, etwas Gutes aus meinem Leben zu machen.“
Sein Anderssein führt dazu, dass Leute ihm hinterherschauen, ihn diskriminieren, oder ihn einfach als „anders“ wahrnehmen. Die Erfahrungen mit Rassismus in den 90er Jahren waren bitter und hart. Er aber dreht einfach den Spieß um – die Leute merken sich sein Gesicht, er fällt auf und versucht das zu nutzen. Im Falle rassistischer Diskriminierung macht er sich einen Spaß draus, sein Gegenüber zu verunsichern, denn er weiß: Rassismus ist das Problem der Rassist*innen, nicht seins. Er bleibt höflich und freundlich, konfrontiert die Person mit den eigenen Widersprüchen und treibt sie ganz langsam in die Enge. Er lächelt freundlich und denkt: „Du wirst mich noch kennenlernen, unterschätz‘ mich ruhig.“
Eine Bilanz

Nguyen Tien Duc. Foto: privat
Nguyen Tien Duc ist dankbar und glücklich: Er ist vielen guten Menschen in seinem Leben begegnet, viele haben ihm geholfen, so wie er auch vielen geholfen hat. Er ist zufrieden mit dem, was er bis jetzt erreicht hat. Wenige Menschen haben so wie er zwei Wiedervereinigungen erlebt, 1975 in Vietnam und dann in Deutschland. Trotz Ruhestand möchte er sich nicht zur Ruhe setzen, sondern Projekte, bei denen Kenntnisse über die vietnamesische und deutsche Kultur benötigt werden, umsetzen. „Ich kann jetzt das Tempo selbst bestimmen und die Arbeit machen, welche mir Spaß bereitet. Ich empfinde das als Luxus“ sagt Duc voller Zufriedenheit und Dankbarkeit.
Nguyen Tien Duc, Jahrgang 1955, ist Vorstandsvorsitzender des LAMSA e.V. Er hat von 1992 bis 2020 als Koordinator des Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas in Magdeburg gearbeitet.
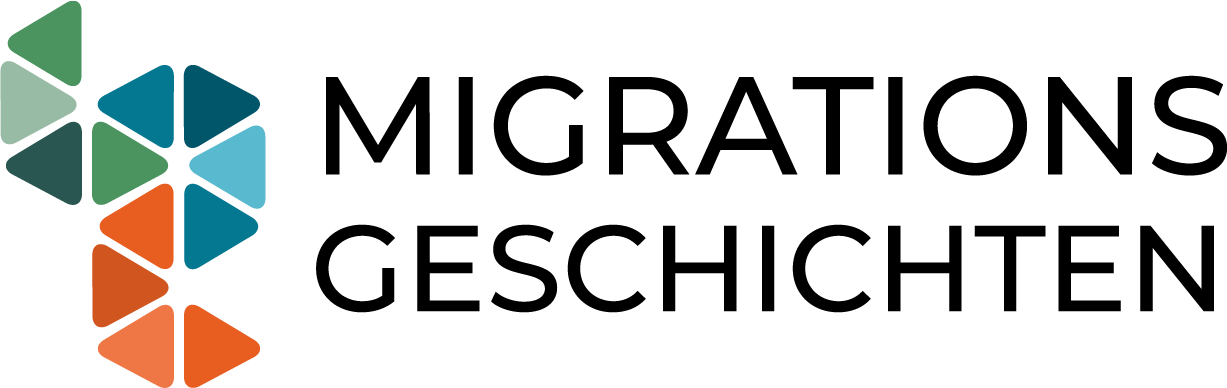








Ich hatte das große Glück, Nguyen Tien Duc 1987-1990 kennenzulernen. Er war stets ein sympathischer und hilfbereiter Mentor <3