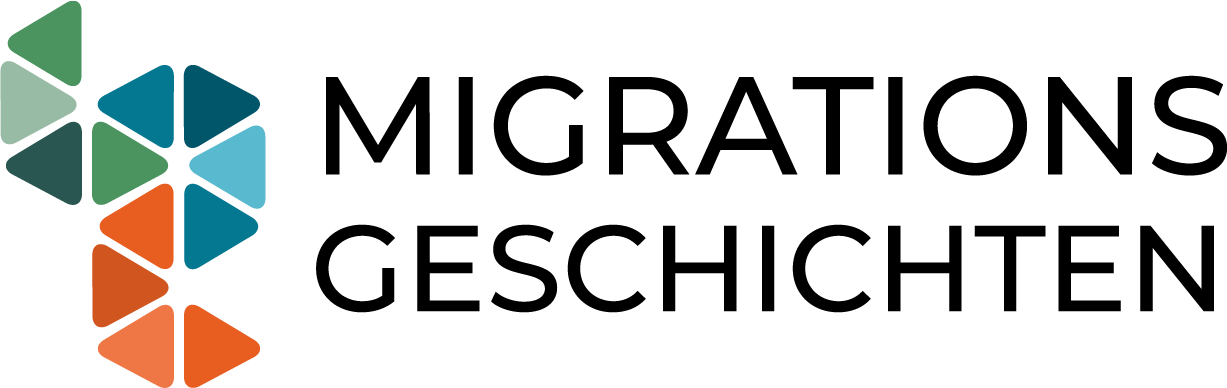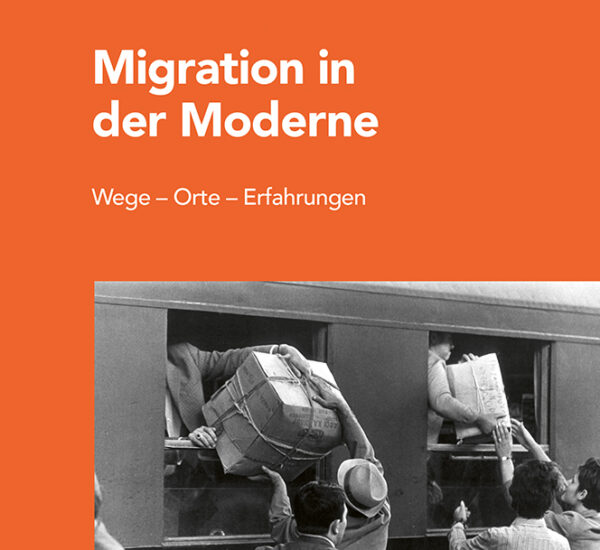Im Jahr 1993 habe ich als Schülerin im Ethik-Unterricht ein Referat gehalten. Die sogenannte „Asyldebatte“ befand sich gerade auf einem Höhepunkt der Eskalation. Die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen waren schon einige Zeit her gewesen, jetzt standen rechtsextreme Brandanschläge im Westen Deutschlands im Mittelpunkt, in Mölln und Solingen zum Beispiel gab es Todesopfer. Als Reaktion darauf entstanden die oft zitierten Lichterketten, aber auch Vereine wie die Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. und Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., die dem auf zivilgesellschaftlicher Ebene etwas entgegensetzen wollten. Diese Vereine kannte ich allerdings nicht.
Überkommenes Abstammungsprinzip über Bord geworfen
Aber es gab damals ein Buch von dem Grünen-Politiker und damaligen Frankfurter Referenten für multikulturelle Angelegenheiten Daniel Cohn-Bendit und seinem Mitarbeiter Thomas Schmid, das großen Widerhall fand und der zugespitzten Debatte eine neue, konstruktive Schlagseite gab. „Heimat Babylon“ hieß es. Es definierte den damals bereits diskreditierten Begriff des Multikulturellen neu und plädierte für eine „multikulturelle Demokratie“, die ehrlich mit Konflikten umgeht, sich aber vor allem endlich als Einwanderungsland begreifen sollte. Dieses Buch erzählte die Geschichte der sogenannten bundesdeutschen „Gastarbeiter“ nach und benannte dabei auch den Wunsch vieler gebliebener Einwandererfamilien als Illusion, irgendwann doch zurück ins ursprüngliche Heimatland zu gehen. Das Fazit der Autoren: Das überkommene Verständnis vom deutschen Abstammungsprinzip müsse über Bord geworfen, auf Dauer angelegte Einwanderung vernünftig reguliert werden.
Über dieses Buch hielt ich in meinem Ethik-Kurs ein Referat, und ich habe selten eine so lebhafte, aber auch ernsthafte Diskussion im Unterricht erlebt wie im Anschluss daran. Es ging nicht mehr nur um das tagespolitische Geschehen, sondern darum, wie wir zusammenleben wollen und können. Nach der Doppelstunde wollte niemand in die Pause, und die Lehrerin beschloss, die Diskussion in der nächsten Ethik-Stunde fortzuführen.
Allgemein wurden an meinem Gymnasium in Niedersachsen damals die Themen Migration und Rassismus stark diskutiert. Das lag wesentlich an dem Engagement von Mitschülerinnen und Mitschülern mit Migrationsgeschichte wie zum Beispiel dem späteren SPIEGEL-Redakteur Hasnain Kazim. Sie wollten sich die Welle rassistischer und rechtsextremer Anfeindungen nicht bieten lassen. Das hat viele in der Schule sehr beeindruckt.
Mit historischem Ansatz zum „neuen Wir“
An die Begebenheit mit dem Referat habe ich mich erinnert, als ich nun das Buch „Das neue Wir. Warum Migration dazugehört. Eine andere Geschichte der Deutschen“ gelesen habe. Ganz ähnlich wie Cohn-Bendit und Schmid nutzt der Autor Jan Plamper einen historischen Ansatz, um die Herausforderungen der heutigen Migrationsgesellschaft zu diskutieren. Plamper lehrt Geschichte am Goldsmith College in London und verfügt über einen mitreißenden und allgemeinverständlichen Schreibstil; er hat also durchaus das Potenzial, viele Menschen zu erreichen.
Die problembeladene Kategorie vom „Migrationshintergrund“
„Das neue Wir“ ist in einer Situation erschienen, die in vielem an die Lage Anfang der 1990er erinnert. Aber heute stehen wir doch woanders. Die meisten meiner ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler mit Migrationsgeschichte haben inzwischen wahrscheinlich seit Jahrzehnten die deutsche Staatsangehörigkeit, ihre Kinder sowieso. Die dauernde problembeladene Rede vom Migrationshintergrund geht da ordentlich am Thema vorbei. Zudem sind die Stimmen vor allem von jungen Menschen, deren Familien einmal eingewandert waren, heute ungleich lauter zu hören. Dass die Black Lives Matter Bewegung auf Deutschland übergegriffen hat, ermöglicht Diskussionen etwa über Rassismus, die schon längst hätten geführt werden müssen.
Cohn-Bendit und Schmid bemühten sich in ihrem Buch in den 1990er Jahren darum, einen realistischeren Blick auf das Phänomen Einwanderung zu werfen als es bei vielen im links-alternativen Milieu bis dahin der Fall war. Die Autoren benannten Probleme und Konflikte und halfen so, eine multikulturelle Utopie in ein politisch umsetzbares Anliegen zu verwandeln. Heute müsste hingegen versucht werden, aus den zahlreichen Problembeschreibungen wieder in eine lösungsorientierte Richtung mit positivem Grundansatz zu gelangen.
Lösungswege gehören in den Mittelpunkt
Genau das tut Jan Plamper mit seiner historischen Herleitung. Er beschreibt die größeren Einwanderungsphasen seit dem Zweiten Weltkrieg und gibt dabei vielen Perspektiven einen Raum, benennt die zentralen gesellschaftlichen Konflikte der jeweiligen Zeitabschnitte. In den Mittelpunkt stellt er jedoch Erfolge und Errungenschaften, plädiert dafür, Migrationsgeschichten als eine positive Ressource zu betrachten und zum Beispiel die Mehrsprachigkeit wieder bewusst zu fördern und wertzuschätzen. Und gleichzeitig deutsche Staatsangehörige endlich ohne Wenn und Aber als Deutsche zu betrachten.
Jan Plampers Buch strahlt einen großen Optimismus aus, ohne die angespannte Realität zu verkennen, und darin steckt ein großes Wirkungspotenzial. Sein Plädoyer für das gesellschaftliche „Salatschüssel-Modell“ vertritt er mit Leidenschaft, die auch auf eigener Erfahrung mit anderen Migrationsgesellschaften basiert.
Für ein neues Selbstverständnis als Migrationsgesellschaft
„Heimat Babylon“ war damals wahrscheinlich ein Meilenstein im Vorfeld der Bemühungen der rot-grünen Bundesregierung nach 1998, ein Einwanderungsgesetz zu entwerfen und das Staatsbürgerrecht zu modernisieren. Der Plan ist dann auf halber Strecke stecken geblieben. Und nach dem verheerenden 11. September 2001, der im kommenden Jahr auch schon 20 Jahre her ist, gingen die Debatten schnell in ganz andere Richtungen.
Jan Plampers erfrischend optimistisches Buch könnte eine Grundlage bilden für einen neuen Anlauf, in Deutschland zu einem Selbstverständnis als Migrationsgesellschaft zu finden, die alle umfasst, die hier leben. Bevor das Corona-Virus kam, hat Plamper über sein Buch bereits lebhafte Diskussionen in Schulen geführt. In Heft 105 der Zeitschrift „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ finden Sie einen Beitrag darüber.