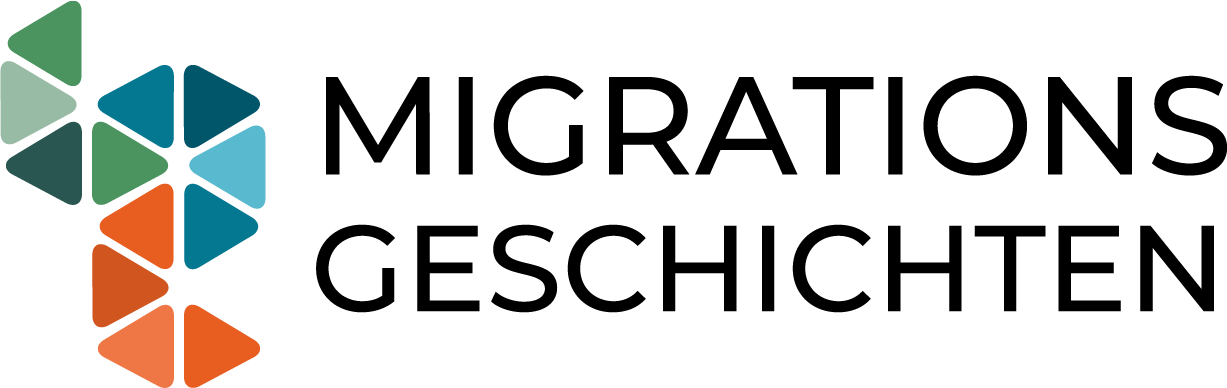Was weißt du über Zwangsarbeit während der NS-Zeit? Vermutlich sind dir unbeschreiblich grausame Verbrechen aus dem nationalsozialistischen Lagersystem bekannt, etwa das Konzept der Vernichtung durch Arbeit. Vielleicht hast du ebenfalls davon gehört, dass neben KZ-Häftlingen auch Millionen anderer ausländischer Arbeiter*innen aus ganz Europa ins Reich verschleppt wurden, um die Kriegswirtschaft der Deutschen aufrechtzuerhalten. Etwas weniger bekannt ist hingegen, dass die Anzahl aller Zwangsarbeiter*innen in Deutschland bei über 13 Millionen lag. Es wurden also mehr Menschen von den Deutschen verschleppt und zur Arbeit gezwungen, als heute etwa in Österreich leben.
In fast jedem Dorf gab es Zwangsarbeiter*innen
Wenn du nun darüber nachdenkst, wo diese Arbeiter*innen gelebt und gearbeitet haben, welche Bilder kommen dir da in den Kopf? Evtl. denkst du an riesige Rüstungsproduktionsbetriebe, wie etwa das Volkswagenwerk in der von den Nationalsozialist*innen aufgebauten Stadt Wolfsburg. Oder aber die gefährliche Arbeit in den Bergwerken, z.B. in den Zechen im Ruhrgebiet. Wären dir aber auch Zwangsarbeiter*innen in der Landwirtschaft in den Sinn gekommen? Und wusstest du, dass Zwangsarbeit kein Phänomen der riesigen Gutshöfe war? Zwangsarbeit war auch fester Bestandteil sehr vieler kleinerer Bauernhöfe bis hin zu winzigen Einsiedlerhöfen.
Warum werden Zwangsarbeiter*innen in der Landwirtschaft vergessen?
Tatsächlich lebten und arbeiteten Zwangsarbeiter*innen in fast sämtlichen deutschen Kleinstädten oder Dörfern. Solltest du heute in einer oder einem davon wohnen: Sind dir Erinnerungsstätten oder -orte bekannt, die auf die lokale Geschichte von Zwangsarbeit aufmerksam machen, bzw. den dabei ermordeten Zwangsarbeiter*innen gedenken? Nein? Dann gehört dein Heimatort zur erschreckenden Mehrheit im ländlichen Raum Deutschlands, die dieses Kapitel ihrer Geschichte vergessen haben. Oder sie sehen keinen Bedarf darin, sich mit Verbrechen ihrer eigenen Gemeinde auseinander zu setzen.
Der Fall Gabriel Kulczycki
Ähnlich ging es mir 2019. In dem Jahr startete ich eine Recherche über einen ungewöhnlichen Grabstein auf dem Friedhof meiner Heimatstadt Wolfhagen in Nordhessen. (Kürzlich veröffentlichte ich darüber einen englischsprachigen Artikel.) Dabei entdeckte ich recht früh, dass der Grabstein einem ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiter, Gabriel Kulczycki, gehörte. Er wurde 1943 in den Altkreis Wolfhagen verschleppt und musste auf verschiedenen Höfen Zwangsarbeit leisten. Was mich allerdings an seinem Fall neugierig werden ließ, sind zwei ganz andere Faktoren. Erstens verstarb Gabriel nicht während des zweiten Weltkrieges, sondern erst 1961, also gut 15 Jahre nach seiner Befreiung. Zweitens verbrachte er diese Jahre zwar fast ausschließlich in Wolfhagen. Aber er war seinen deutschen Nachbarn gleichzeitig ein großes Rätsel. Niemand wusste wirklich, wieso der Ukrainer überhaupt in Deutschland geblieben war.
Dieser Text soll nicht die Stationen und Hintergründe von Gabriels Leben in Deutschland nacherzählen. Er erörtert auch nicht, welche (Selbst-)Zeugnisse über sein Schicksal existieren. Dies und vieles weitere rund um den Fall kann gerne im ursprünglichen Beitrag nachgelesen werden. Was ich hier vielmehr behandeln möchte, ist das, was um Gabriel herum passierte und sich teilweise noch bis heute hält. Nämlich: wie begegnete die örtliche Bevölkerung Gabriel in der Nachkriegszeit als Einwohner ihrer Gemeinde? Welche Erklärungsmuster entwickelte sie für ihn? Und schließlich welche verschiedenen Ebenen von Erinnerungskultur werden noch heute mit seinem Grabstein verbunden? Gabriels Fall ist damit nicht nur ein Beispiel für einen bislang wenig beachteten Aspekt deutscher Migrationsgeschichte. Er zeigt auch wunderbar, wie Erinnerungskulturen durch Migration neu belebt werden können.
Ein Knecht in Wolfhagen
Das erste, was man über Gabriel erfährt, wenn man in den Büchern des lokalen Geschichtsvereins nachliest, ist, dass der Knecht eines örtlichen Bauern ein eigenbrötlerischer Außenseiter war. Er kapselte sich selbst von seinen Nachbarn ab und misstraute Jedem. Zudem führen Zeitzeugen an, dass ihn selbst die Wolfhager Kinder verspottet hätten, wenn er über die Straße ging. Als Grund reichte wohl seine für Wolfhagen ungewöhnliche Art sich zu kleiden und der Umstand, dass er gerne viel Zeit mit den Tieren auf dem Hof seines Arbeitgebers verbrachte. Tatsächlich trennte Gabriel wohl neben der sozialen Stigmatisierung auch eine Sprachgrenze von den anderen Wolfhager*innen. Er konnte zwar fließend Ukrainisch und Polnisch, aber selbst 1961 noch kaum Deutsch und war Analphabet.
Gabriel der Kollaborateur?
Zusätzlich hatte (und in einigen Punkten hat) die örtliche Bevölkerung auch nur ein begrenztes Interesse, ihren dauerhaft unbekannten Nachbarn zu verstehen. Dies trifft insbesondere auf ihre fantastischen Erklärungsversuche dafür zu, wieso er all die Jahre in Wolfhagen lebte, ohne je in sein Heimatdorf in der Ukraine zurückzukehren. Hierbei hat sich bis vor wenigen Jahren eine nicht zu belegende Geschichte gehalten. Gabriel habe in der Idel-Ural-Legion der Wehrmacht gekämpft und sei aus Angst vor Bestrafung in Deutschland geblieben.
Diese Geschichte ist nicht nur in sich widersprüchlich (wieso sollte ein Westukrainer sich schließlich gerade einer Wehrmachtseinheit anschließen, die hauptsächlich aus Turkvölkern der Wolgaregion bestand?). Sie übersieht außerdem, dass Gabriel definitiv hier zur Arbeit gezwungen wurde. Das belegen in der Nachkriegszeit entstandene Listen über ausländische Arbeitskräfte im Altkreis, die heute in lokalen Archiven liegen. Viel zu lange, so scheint es, hat sich die Wolfhager Bevölkerung mit den bequemsten Erklärungsmustern zufriedengegeben. Und diese wurden unhinterfragt weiterzählt.
Der Grabstein in der Hecke
Das deutlichste Zeichen einer gewissen Faszination und doch gleichzeitigem Desinteresse am Schicksal Gabriels ist allerdings dessen Grabstein, der noch heute auf dem Wolfhager Friedhof steht. Es handelt sich dabei um einen Stein in Form eines orthodoxen Kreuzes. Das ist ungewöhnlich in einer Stadt ohne orthodoxe Kirche und somit einzigartig in seiner Form auf dem Friedhof. Viel beachtlicher ist jedoch, dass das Kreuz zusätzlich auch noch ohne jede Inschrift halb versteckt aus der Friedhofshecke ragt. Ich habe bis heute nicht klären können, wer eigentlich diesen Grabstein bezahlt und aufgestellt hat. Denn Gabriel verstarb ohne Angehörige und völlig vereinsamt in Deutschland.
Da der Stein überdies keine Inschrift trägt, kann er nur durch Aussagen von Zeitzeugen überhaupt Gabriel zugeordnet werden. Genauso interessant ist allerdings die Erklärung dafür, weshalb das Kreuz heute in der Hecke steht. Nachdem die Ruhezeit für Gabriels Grab 1986 ablief, habe man, laut einem Friedhofsmitarbeiter, den Grabstein aufbewahrt, da er ja „besonders“ sei und an diesem – damals gut einsehbaren – Platz positioniert, der dann im Lauf der Zeit mit der Hecke zuwucherte.

Migration der Nachwendezeit und Erinnerungskultur
Wäre es dabei geblieben, würde der Grabstein heute vor allem für die fast schon exotisierende Schaulust der örtlichen Bevölkerung stehen, als denn ein Erinnerungsort an einen Verstorbenen sein. Doch nach 1990 erlebte Wolfhagen erfreulicherweise den Zuzug einer großen ukrainischen Gemeinschaft. Sie entdeckte das Kreuz in den folgenden Jahren neu. Auch, wenn die Immigrant*innen die Geschichte Gabriels nicht kannten und eigentlich aus einer ganz anderen Ecke der Westukraine stammten, machten sie den Grabstein zu einem symbolischen Gedenkort. So sollen sie an Allerheiligen bis zu 50 Kerzen für ihre eigenen Verstorbenen dort aufgestellt haben. Dies hat in den letzten Jahrzehnten deutlich nachgelassen. Aber noch heute findet man ab und an Rosen vor dem Stein, die ich in dieser Tradition verorten würde.
Holt den Grabstein aus der Hecke!
Der Grabstein verbindet vier Aspekte, die für sich allein schon Grund genug wären, ihm endlich mehr Beachtung zu schenken.
Erstens steht er für das tragische Schicksal Gabriel Kulczyckis, der nicht nur nach Wolfhagen zur Zwangsarbeit verschleppt und danach ausgegrenzt wurde. Sondern er steht auch dafür, dass ihm bis in die jüngsten Jahre posthum abgesprochen wurde, überhaupt ein Zwangsarbeiter gewesen zu sein.
Zweitens kann der Stein auch als Hinweis auf mindestens neun weitere in Wolfhagen beerdigte Zwangsarbeiter*innen verstanden werden. Sie hatten nicht das Glück, 1945 zu überleben. Heute erinnert nichts mehr an sie.
Drittens steht er für Zwangsarbeiter*innen in der Landwirtschaft als Teil unserer regionalen Migrationsgeschichte. Eine Geschichte, die die meisten deutschen Kleinstädte und Dörfer teilen und die noch nicht annähernd als aufgearbeitet gelten kann.
Viertens symbolisiert das Kreuz einen Wandel und eine Anreicherung der Erinnerungskultur durch den Zuzug von Migrant*innen ab den 1990ern. Dass das Kreuz nach wie vor in der Hecke steht, macht mich sehr traurig. Diese Tatsache zeigt, wie wenig Beachtung dem Schicksal von ehemaligen Zwangsarbieter*innen in meiner Heimatstadt geschenkt wird. Um dies zu ändern, muss endlich eine neue Perspektive auf Zwangsarbeit in der Landwirtschaft geschaffen werden. Ein Appell, der sich genauso an die Forschung wie auch an die interessierte Öffentlichkeit richtet.
In dem Beitrag Afrika und Mecklenburg-Vorpommern – Eine Beziehungsgeschichte lest ihr ein weiteres Plädoyer für Migrationsgeschichte als Regionalgeschichte.