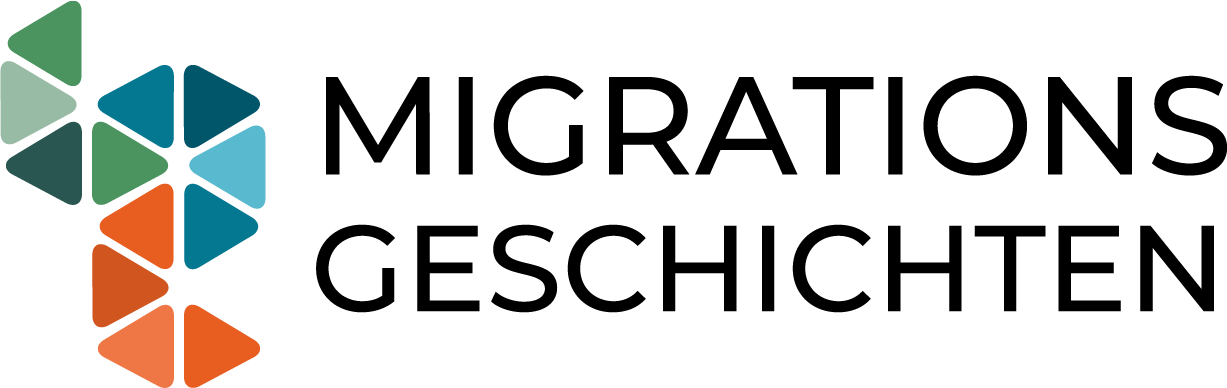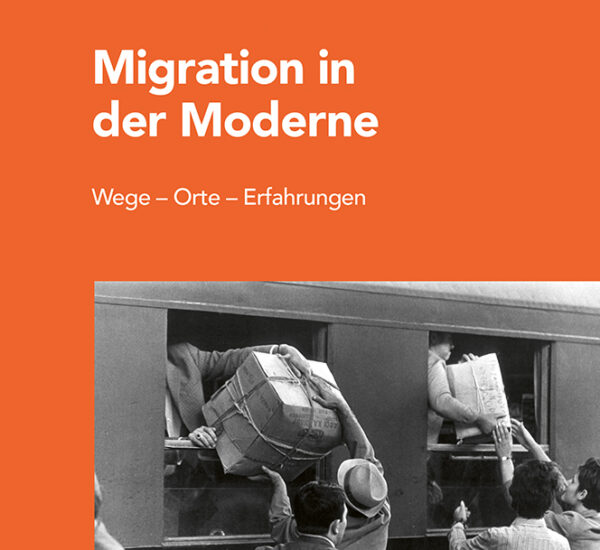Umgang mit Antisemitismus unter Muslim*innen und antimuslimischem Rassismus in der Bildungsarbeit
„In meiner Gruppe ist ein Junge, der Hitler verherrlicht und gegen Juden hetzt. Keine Ahnung, wo er herkommt, Türkei, Marokko oder so was, aber auf jeden Fall ist er Muslim.“
Mit obiger Aussage wandte sich eine Lehrkraft an die Anne Frank Bildungsstätte und bat um Unterstützung bei einem adäquaten Umgang mit „muslimischem Antisemitismus“. Gut so: Genau hinzuschauen und zuzuhören, wenn Jugendliche kontroverse Aussagen machen, ist eine wesentliche und herausfordernde Aufgabe von Pädagog*innen. Im genannten Fall ist es dringend notwendig, die Verherrlichung Hitlers und die Hetze gegen Juden und Jüdinnen zu problematisieren und pädagogisch zu intervenieren. Gleichzeitig gehört es zur Aufgabe von Pädagog*innen, selbstreflexiv zu handeln und eigene vorhandene Vorurteile kritisch zu hinterfragen. In diesem Beispiel paarte sich der gute Wille, etwas gegen Antisemitismus zu tun, mit einer gängigen Fremdzuschreibung, zugespitzt formuliert: Muslimische Jugendliche seien per se antisemitisch: „… auf jeden Fall ist er Muslim.“ Dies passiert nicht selten.
„Die Muslime sind …“
Nicht nur in Deutschland, sondern in zahlreichen europäischen Staaten ist eine Zunahme islamfeindlicher und antimuslimischer Ressentiments zu beobachten, ebenso wie Angriffe gegen Muslim*innen und Orte, an denen sie sich aufhalten. Studien und Umfragen belegen, dass die feindlichen Stimmen und Stimmungen gegen Muslim*innen im Schul- und Arbeitsalltag zu hören und zu spüren sind. Mediale Berichterstattung über „den Islam“ und „die Muslime“ ist seit geraumer Zeit mit Gewalt, Terror und Unterdrückung konnotiert. Der Kommunikations- und Islamwissenschaftler Kai Hafez stellt in seinen Diskursanalysen fest, dass der Islam und Muslim*innen mehrheitlich negativ dargestellt werden. Trotz einzelner Beiträge, die sich um eine differenzierte Berichterstattung über den Islam, über Muslim*innen und die islamische Welt bemühen, gehe es mehrheitlich um Bedrohungsszenarien und gewaltvolle Themen. Die verschiedenen Merkmale, die Muslim*- innen als solche identifizieren und erkennbar machen, sind dabei willkürlich und undifferenziert. Wenn es in aktuellen Debatten um Migration und Integration fast schon selbstverständlich um „die Muslime“ geht, ist dies laut Yasemin Shooman das „Resultat einer Wahrnehmungsverschiebung. Sie hat zur Folge, dass aus den Menschen, die vormals als Gastarbeiter*innen oder Ausländer*innen wahrgenommen wurden, zunehmend Muslim*innen geworden sind“. Dabei sei zu beobachten, dass die Bezeichnungen „Migrant“, „Araber“, „Türke“ und „Muslim“ austauschbar sind und ähnliche Verwendung finden.
Die Gemüter bewegt nun die Frage, ob der Islam, nein: die Muslim*innen zu Deutschland gehören.
Unabhängig davon, ob die Frage bejaht oder verneint wird, ist sie selbst ein praktisches Beispiel dafür, wie Muslim*innen zu „anderen“ gemacht werden. Über sie wird gesprochen, über ihre Zugehörigkeit gestritten, über ihre Anpassungsfähigkeit gerätselt. Während sich deutsche Muslim*innen geäußert haben und das noch immer tun, bleibt das „Wir“ weiterhin exklusiv. Wie aber können wir vor diesem Hintergrund angemessen über aktuelle antisemitische, homophobe und andere abwertende Einstellungen in der Migrationsgesellschaft reden? Letztlich geht es um die Art und Weise der Kritik, der Sprache und um eine Frage von Repräsentanz, sprich: Wer spricht wie und mit wem?
Antisemitismus unter Muslim*innen
Wenn es heute um Antisemitismus geht, liegt der Fokus besonders auf der Verbreitung antisemitischer Einstellungen bei Muslim*innen. Es sollte jedoch klar sein, dass der Hass auf Juden und Jüdinnen nicht erst durch die Migration von Muslim*innen in der postnationalsozialistischen Gesellschaft zum Problem wurde. Denn dort ist eine ganz spezifische Form des Antisemitismus sichtbar, der nicht trotz, „sondern wegen Auschwitz“ artikuliert wird. Der israelische Psychoanalytiker Zvi Rex sagte sarkastisch: „Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nicht verzeihen.“ Nun kennen die meisten nichtmigrantischen und nichtmuslimischen Pädagog*innen solche Formen der Judenfeindschaft aus dem Motiv der Erinnerungsabwehr heraus und können damit womöglich entsprechend leichter umgehen – schließlich kommt es ihnen bekannter vor.
Die nun verkürzte Erklärung, Antisemitismus sei vor allem unter Muslim*innen verbreitet, wird dem Phänomen nicht gerecht. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Antisemitismus muss alle Artikulations- und Erscheinungsformen sowie Ausprägungen in spezifischen Milieus einbeziehen – und dabei nicht außer Acht lassen, wie verflochten und wechselwirksam beispielsweise rechtsextreme und islamistische Artikulationsformen sind.
Antisemitische Einstellungen in islamisch geprägten Gesellschaften und bei deutschen Muslim*innen zu leugnen ist ähnlich pauschal und falsch, wie einen Zusammenhang zwischen Muslimsein und antisemitischen Haltungen zu vermuten.
Ein Ergebnis der Antisemitismusforschung heute ist, dass der in islamisch geprägten Gesellschaften existierende Antisemitismus im Ursprung ein Phänomen ist, das im Zuge des Kolonialismus aus Europa kam. Michael Kiefer beschreibt drei historische Phasen dieser Entwicklung und weist darauf hin, dass sich der Antisemitismus an eine „islamistische Semantik“ angepasst habe. Kiefer verwendet daher den Begriff des „islamisierten Antisemitismus“.
So ist das Feindbild des „Juden“ aus dem europäischen Antisemitismus und der nationalsozialistischen Ideologie von arabischpalästinensischer Seite nach der Staatsgründung Israels 1948 durch das konstruierte Feindbild „Israel“ erweitert und abgewandelt worden. Dieser zunächst recht simpel erscheinende Transfer ist ein wesentlicher Aspekt für das Verstehen antisemitischer Aussagen und Deutungen in der heutigen Zeit, besonders wenn sie von Muslim*innen kommen.
Der islamistische Antisemitismus ist als ein modernes Phänomen zu begreifen, das sich durch das Aufkommen fundamentalistischer Gruppen im Laufe des 20. Jahrhunderts durchsetzen und tief in der Gesellschaft verbreiten konnte. Zu seiner Spezifik tragen diverse Ereignisse in islamisch geprägten Ländern sowie die Zunahme transnational agierender islamistischer Gruppen bei. Auch spielt der Nahost-Konflikt eine besondere Rolle. So wird allein die Staatsgründung Israels bis heute als eine Fortsetzung des europäischen Kolonialismus propagiert und das Existenzrecht Israels infrage gestellt. In den zeitgleichen politischen Entwicklungen und Modernisierungsprozessen in arabischen und mehrheitlich islamischen Staaten wurden antisemitische Feindbilder verstärkt und massiv verbreitet. Die Krisen und teils gescheiterten Nationalstaatswünsche arabisch-muslimischer Bewegungen bewirkten zum Teil eine tiefe Frustration gegenüber Europa und “dem Westen“. Durch den Erfolg islamistischer Bewegungen wirkten antisemitische Stereotype und Feindbilder in weite Teile der islamisch geprägten Gesellschaften hinein.
Antimuslimische Wahrnehmung
von Antisemitismus Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem entgegengewirkt werden muss. Der Fokus auf Muslim*innen birgt sowohl die Gefahr einer rassistischen Pauschalisierung als auch der Externalisierung von Antisemitismus. Der weit verbreitete Antisemitismus in unterschiedlichen Gruppen im postnationalsozialistischen Deutschland wird damit relativiert und das Problem verlagert. Muslimische Jugendliche in Deutschland, deren Familien einen Migrationshintergrund in Staaten und Bevölkerungsgruppen haben, die im Konflikt mit Israel stehen, kennen womöglich spezifische antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien. Diese Narrative werden von der nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft oftmals schlecht oder gar nicht verstanden, was viele Pädagog*innen verunsichert. Die Reaktion ist dabei entweder eine Skandalisierung oder das Nicht-Benennen aus Angst vor dem Vorwurf, rassistisch oder islamfeindlich zu sein.
Herausforderung: Gleichzeitigkeit von Antisemitismus- und Rassismuskritik
Die Herausforderung für pädagogisch Verantwortliche ist es, in kritischem Bewusstsein anzuerkennen, dass muslimische Jugendliche Rassismus und Stigmatisierung erleben, aber zugleich antisemitische Einstellungen haben können. Beide Realitäten dürfen nicht gegeneinander aufgewogen werden. Nur weil Muslim*innen Rassismuserfahrungen machen, dürfen ihre antisemitischen Äußerungen nicht ignoriert oder auf paternalistische Art bagatellisiert werden.
In pädagogischen Räumen muss klar sein, dass Grenzen zu ziehen sind, wenn Antisemitismus, Rassismus oder andere Abwertungen artikuliert werden. Es sollte selbstverständlich sein, immer zu reagieren, wenn menschenverachtende Äußerungen gemacht werden. Dabei besteht das Interventionsziel darin, (potenzielle) Betroffene zu schützen. Diesen kann dadurch glaubhaft signalisiert werden, dass ihre Erfahrungen und Verletzungen ernst genommen werden und es Ansprechpartner*innen und Räume gibt, die sie aufsuchen können. Dort brauchen sie vor weiterer Verletzung durch Relativierung oder Negierung des Erlebten, vor ungewollter Veröffentlichung oder dem Verlust von Handlungsfähigkeit und Kontrolle keine Angst zu haben. Nicht selten verheimlichen Jugendliche aufgrund schlechter Erfahrungen ihre religiöse oder nationale Zugehörigkeit.
Von besonderer Relevanz ist dabei die Sprache und Wortwahl der Pädagog*innen: Während der Intervention gegen Diskriminierung sollten sie nicht selbst fremdzuschreibend und kulturalisierend werden – wie im Eingangszitat „… auf jeden Fall ist er Muslim“. Auch ist es wichtig, zwischen Person und Problem zu trennen: Jugendliche in der Adoleszenz orientieren sich und probieren immer wieder Neues aus – dazu gehören jugendkulturelle Codes, Slang und Rhetorik. Ein Jugendlicher, der „du Jude“ als Schimpfwort verwendet, sollte nicht pauschal als Antisemit abgestempelt, sondern die Beschimpfung sollte als antisemitisch erklärt werden. Jugendliche bleiben veränderungsfähig. Ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich von ihren Aussagen zu distanzieren.
Eine konkrete Handlungsempfehlung für ein besseres Verständnis der Jugendlichen mit muslimischen Hintergründen ist es, mehr muslimische Pädagog*innen in den relevanten Handlungs- und Praxisfeldern zu beschäftigen. Wenn sich Jugendliche kaum oder selten mit Autoritätspersonen identifizieren können, kann dies zu einem verstärkten Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit führen. Daher ist es wichtig, hier neue Perspektiven und Narrative einzubringen – eine dringende und notwendige Bereicherung des pädagogischen Könnens in der Migrationsgesellschaft.