Im August 1952, vor knapp 70 Jahren, belebte der Film „Toxi“ die westdeutschen Kinos. Im Zentrum der Handlung steht das Schicksal eines ausgesetzten, dunkelhäutigen Mädchens. Die Tochter eines afroamerikanischen Soldaten und einer deutschen Frau sucht Obdach bei der ebenfalls deutschen Familie Rose. Hintergrund für den Erfolg des Filmes stellten zeitgenössischen Debatten um die Schwarzen Besatzungskinder in der Bundesrepublik dar.
Besatzungskinder nach dem Zweiten Weltkrieg
1945, knapp sechs Jahre nachdem das nationalsozialistische deutsche Reich einen Vernichtungskrieg unter rassistischen Vorzeichen begann, besetzten alliierte Soldaten aus Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und den USA das besiegte Land. Einige Monate später kamen die ersten Kinder der ausländischen Soldaten und deutschen Frauen zur Welt. Die Umstände unter welchen sie gezeugt wurden, unterschieden sich von Fall zu Fall. Während ein Teil der Besatzungskinder aus einer Vergewaltigung hervorging, entstammten andere einer Liebesbeziehung.
Bis heute ist die Zahl der betroffenen Kinder unklar. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge lebten Mitte der 50er Jahre zwischen 67.000 und 94.000 Besatzungskinder in Westdeutschland. Ihre Anzahl in der DDR wurde nicht eigens ermittelt. In beiden deutsche Gesellschaften litten die „Kinder des Krieges“ sowie ihre Mütter unter alltäglichen Diskriminierungen. Zwar besaßen sie die deutsche Staatsbürgerschaft, als Söhne und Töchter der alliierten Soldaten wurde ihnen jedoch oftmals eine vermeintliche Andersartigkeit zugewiesen.
Unklare Zuständigkeiten
Zu den gesellschaftlichen Anfeindungen kamen für die Kinder und ihre Mütter auch finanzielle Schwierigkeiten hinzu. Da die Soldaten nur wenige Monate bis Jahre am selben Ort stationiert waren, verließen die meisten Väter ihre Familien bereits kurze Zeit vor oder nach der Geburt des Kindes. Eine Nachverfolgung, geschweige denn ein gesicherter Nachweis der Vaterschaft, wurde dadurch erheblich erschwert. Zudem verhinderten Militärgesetze eine Unterhaltsklage gegen Angehörige der jeweiligen Armee. Das Anerkennen der Vaterschaft und bestehender Unterhaltspflichten blieb für die Soldaten damit freiwillig. Die deutschen Jugendämter wiesen die Zuständigkeit wiederum von sich.
Als Folge war der Großteil der Mütter dazu gezwungen, die Kinder alleine und unter oftmals prekären finanziellen Bedingungen groß zu ziehen. Nichtsdestotrotz dauerte es bis 1952, dass die Besatzungskinder Bestandteil öffentlicher Debatten in Westdeutschland wurden. Mit ihrer Einschulung traten erstmals Kinder ausländischer Soldaten in eine Institution außerhalb des privaten Haushalts ein. Im Zentrum der Debatte stand dabei nicht ihr persönliches Empfinden, sondern vielmehr die Frage, wie die deutsche Gesellschaft die Besatzungskinder in ihrer Mitte aufnahm.
Diskussionen um die Schwarzen Besatzungskinder
Eine besondere Rolle spielten hierbei die rund 5.000 Schwarzen Deutschen Kinder von afroamerikanischen Soldaten und deutschen Frauen. Stellvertretend für alle übrigen Besatzungskinder repräsentierten sie eine vermeintliche kulturelle Andersartigkeit. Durch ihre sichtbar dunklere Hautfarbe erzwangen sie zugleich eine Positionierung zu fortbestehenden rassistischen Denkmustern. Als unehelich geborene, Schwarze „Feindeskinder“ waren sie demnach mit einer dreifachen Diskriminierung konfrontiert. Die öffentliche Rezeption des umstrittenen Phänomens afrodeutscher Kinder war aber keineswegs einstimmig.
Integration und Ablehnung
Neben Kritik verbreitete sich auch die Sichtweise, dass eine erfolgreiche Integration der Schwarzen Kinder eine „Wiedergutmachung“ der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg darstellen könnte. Über die Grenzen Deutschlands hinaus wollte man damit die endgültige Überwindung rassistischer Strukturen demonstrieren. Mehrheitlich überwog jedoch sowohl auf amerikanischer wie deutscher Seite eine ablehnende Haltung gegenüber Verbindungen von Schwarzen Soldaten und weißen Frauen. Die daraus hervorgehenden Kinder erhielten die abwertende Bezeichnung „Mischlingskinder“. Nach entsprechenden Stereotypen wurden ihnen angeblich typische Charaktermerkmale wie eine besondere Vorliebe zu Musik, aber auch problematische Verhaltensauffälligkeiten attestiert.
Eine Debatte des Bundestages im März 1952 mündete in dem Vorschlag, das „Problem“ durch die internationale Adoption der afrodeutschen Kinder in die USA zu lösen. Als Grund dafür wurde eine vermeintlich ungünstige mitteleuropäische Witterung für sie genannt. Wenige Monate später erschien in den deutschen Kinos der Film „Toxi“ über ein Schwarzes Besatzungskind. Darin wird zwar einerseits das Bild eines besonders sympathischen Kindes gezeichnet, andererseits folgen auf sein Auftauchen auch Konflikte innerhalb der Familie. Im Happy End des Films erscheint schließlich der leibliche, afroamerikanische Vater, der das Mädchen in die USA mitnimmt.
Die „Brown Babies“ in den USA
Nicht nur von deutscher Seite wurde das Schicksal der Schwarzen Besatzungskinder verfolgt. Bis weit in die 1960er hinein trennten die amerikanische Gesellschaft strikte Segregationsgesetze in weiße und afroamerikanische Staatsbürger. Letzteren standen innerhalb der alliierten Besatzungsarmeen in Deutschland größere Freiheiten zu als in den USA. Daraus ergaben sich Sympathien und ein gesteigertes Interesse an den Schwarzen Deutschen Kindern von Seiten der afroamerikanischen Öffentlichkeit. In Magazinen riefen Journalist:innen zunächst zum Versenden von Care-Paketen auf. Des Weiteren vermittelten sie Patenschaften für die sogenannten „Brown Babies“. In Folge stieg auch die Nachfrage an Adoptionsmöglichkeiten.
Transatlantische Adoption
Offizielles Ziel der Adoptionen war es, die Kinder und ihre Mütter aus ihrer finanziellen Bedrängnis zu befreien. Darüber hinaus ermöglichten sie es afroamerikanischen Paaren trotz strikter Adoptionsvorgaben innerhalb der USA eine Familie zu gründen. Eine der bekanntesten Initiativen zur transatlantischen Adoption stellte die Vermittlungsarbeit der in Deutschland lebenden, afroamerikanischen Journalistin Mabel Grammer dar. Durch ihren „Brown Baby Plan“ und anderen privat organisierte Adoptionen gelangten etwa ein Drittel der Schwarzen Besatzungskinder in afroamerikanische Familien.
Trotz staatlicher Förderung der Adoptionen handelte es sich jedoch um minimal geregelte Verfahren. So emigrierten die Kinder auch im fortgeschrittenen Alter und ohne besondere Sprachkenntnisse, was ihre Integration in den USA erschwerte. Des Weiteren wurde ihr Wohlergehen in den neuen Familien nach der Adoption nicht weiter überprüft. Daraus folgend gelangten Fälle an die Öffentlichkeit, in denen die Kinder als günstige Arbeitskräfte missbraucht oder ausgesetzt wurden. Nicht zuletzt kritisierten auch Stimmen aus der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) die Aktion. Mit Blick auf die amerikanische Segregation vermuteten sie, dass Kinder in Deutschland insgesamt weniger Rassismus ausgesetzt seien. Ende der 1950er Jahre verhinderten deutsche Behörden weitere Adoptionen afrodeutscher Kinder in die USA. Stattdessen adoptierten verstärkt dänische Paare die Schwarzen Besatzungskinder.
Entwicklung ab den 1960er Jahren
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in der BRD der 1960er Jahre verblasste allmählich die Kritik an den Besatzungskindern. Im Zuge des Arbeitskräftemangels waren die inzwischen jungen Erwachsenen ebenso gefragt wie ihre nicht-stigmatisierten Kolleg:innen. In Tageszeitschriften und diversen Magazinen kursierte das Bild der Schwarzen Auszubildenden. Mit ihrer dunklen Hautfarbe stellten sie ein deutlich sichtbares Vorzeigemodell gelungener Integration dar. Daneben präsentierten popkulturelle Medien afrodeutsche, junge Frauen als exotische Verführerinnen. Die Möglichkeit sexueller Verbindungen zwischen Schwarzen Männern und weißen Frauen blieb hingegen unerwähnt.
Bis heute formen vorrangig Fremdzuschreibungen die Vorstellung von Schwarzen „Kinder des Krieges“ als andersartige Exot:innen innerhalb einer weißen Nachkriegsgesellschaft. Ab Mitte der 1990er Jahre verbreiteten sich jedoch erstmals auch autobiografische Berichte der Besatzungskinder. Sowohl in den USA wie in Deutschland haben sich Betroffene zu Vereinen wie der Black German Heritage and Research Group zusammengeschlossen. Sie verfolgen das Ziel einer gemeinsamen Identitätsfindung, -stiftung und -verteidigung. Ihre Hauptaufgabe besteht in der politischen Interessensvertretung afrodeutscher Minderheiten in Deutschland und in den USA. Andere Projekte wie GI Trace.org helfen wiederum bei der Ermittlung ihrer Väter oder ihrer Mütter – eine Suche, die bis heute in den meisten Fällen nicht abgeschlossen ist.
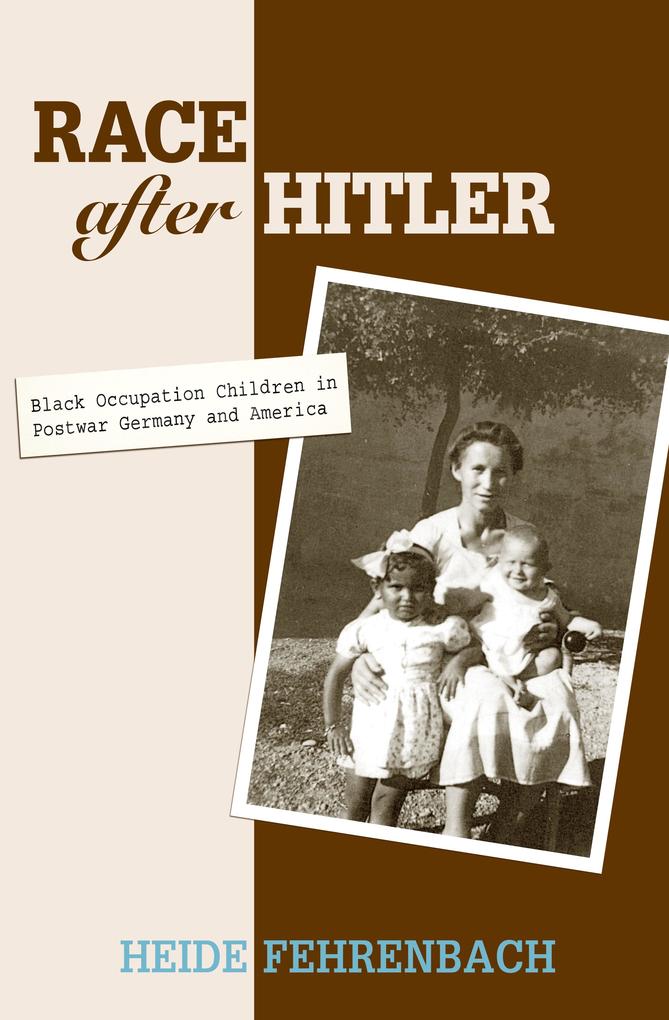
Mehr Informationen zum Thema gibt es in Heide Fehrenbach: Race after Hitler. Black Occupation Children in Postwar Germany and America, erschienen 2007 in Princeton University Press. ISBN: 9780691133799  I 288 Seiten I Preis: $39.95 / £30.00
I 288 Seiten I Preis: $39.95 / £30.00
Titelbild:Cover des Buches Heide Fehrenbach: Race after Hitler. Black Occupation Children in Postwar Germany and America, erschienen 2007 in Princeton University Press.
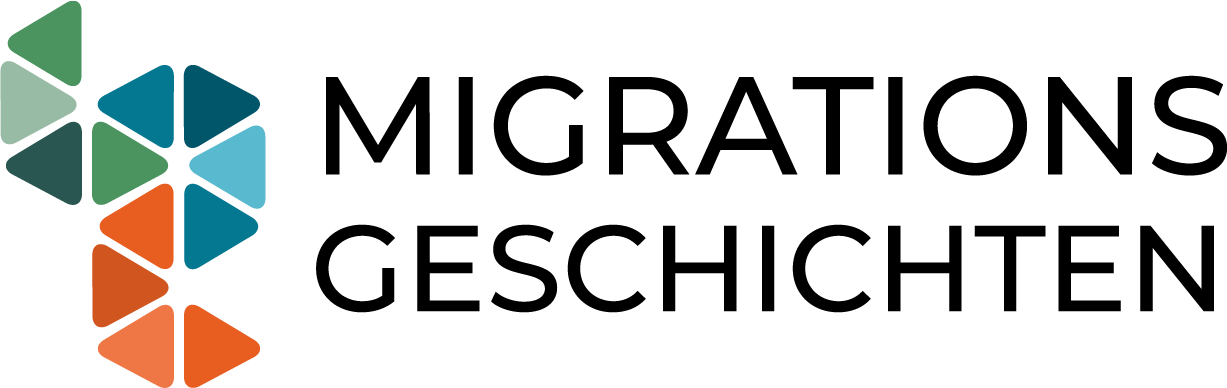




Gelungener Artikel.
Vielen Dank!
Dazu passend der Roman von Susanne Abel „Stay away from Gretchen“, eine zutiefst bewegende Geschichte.