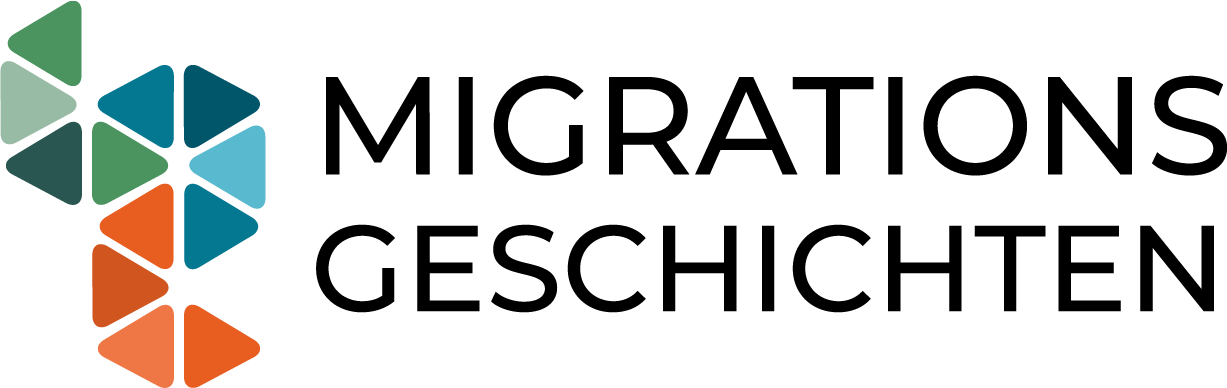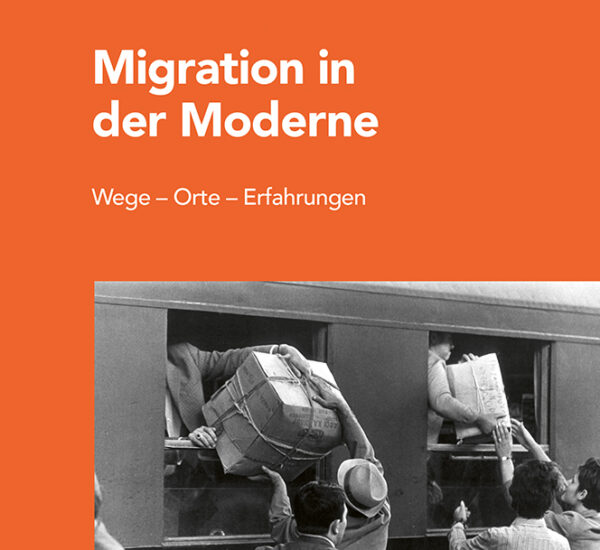Teil I zu queerer Migration anlässlich des Pride Month 2024.
Kampf um Anerkennung
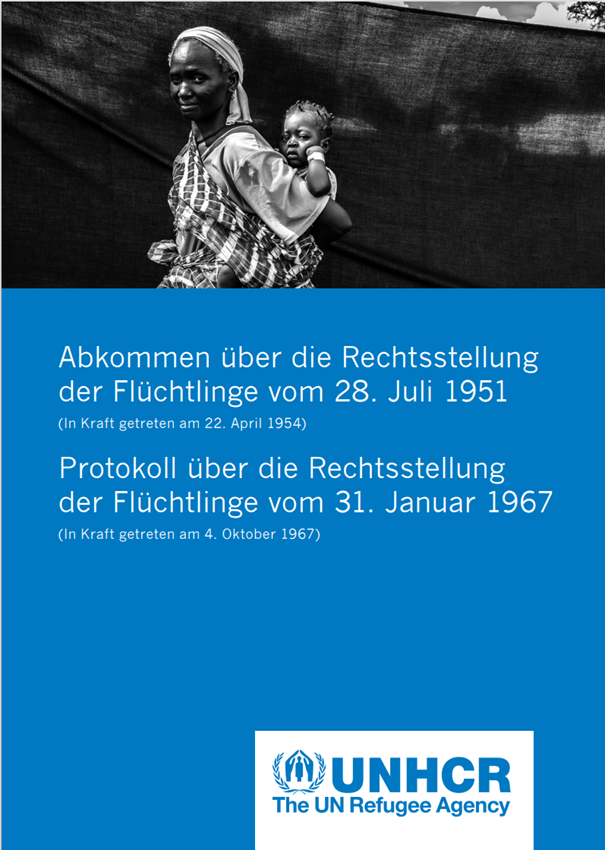
Queere Personen gehören seit der Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 zu denjenigen, denen in der Theorie Asyl gewährt wird. Denn obwohl in den Konventionen keine Rede von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität ist, wird die „begründete Furcht vor Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ genannt. Heute bezieht sich dieser Abschnitt auch auf LGBTQI*-Personen.
Das liegt daran, dass sie zwei wichtige Voraussetzungen erfüllen. Erstens teilen die Mitglieder dieser Gruppe ein angeborenes Merkmal oder einen gemeinsamen Hintergrund, der nicht geändert werden kann oder so grundlegend für die Identität ist, dass eine Person nicht gezwungen werden sollte, darauf zu verzichten. Zweitens hat diese Gruppe in dem betreffenden Land eine spezifische Identität, welche von der umgebenden Gesellschaft als anders wahrgenommen wird. In Deutschland beispielsweise wurde die Tatsache, dass die sexuelle Ausrichtung ‚unabänderlich‘ und damit mit der Ethnizität oder der Religion als Asylgrund vergleichbar ist, 1988 vom Bundesverwaltungsgericht anerkannt.
Das queere Personen aufgrund ihrer Identität jedoch tatsächlich Asyl beantragen können ist das Ergebnis jahrzehntelanger internationaler juristischer Auseinandersetzungen, die erst Mitte der 1990er begannen Wirkung zu zeigen.
Auch in der jüngeren Vergangenheit mussten queere Geflüchtete noch um die Anerkennung ihres Asylrechts kämpfen. Erst 2013 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Geheimhaltung der queeren Identität um Verfolgung zu entgehen nicht erwartet werden darf. Dies bestätigte 2020 auch das Bundesverfassungsgericht.
Deutsches Asylrecht
In Deutschland erhalten Personen heutzutage Asyl, wenn sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beziehungsweise Geschlechtsidentität massive Gewalt, Tod, Haft oder andere Formen unmenschlicher Behandlung in ihrer Heimat erwartet. Dazu gehört beispielsweise die staatliche Verfolgung, sofern Strafen aktiv verhängt werden, welche eine „schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte“ darstellen. Familiäre Verfolgung und gesellschaftliche Diskriminierung gelten nur dann als Asylgrund, wenn der Staat keinen Schutz und rechtliche Konsequenzen bietet und eine schwere Verletzung der Menschenrechte vorliegt.
Aktuelle Lage und Herausforderungen
Obwohl die Zahl queerer Geflüchteter steigt, trauen sich viele noch immer nicht, ihre sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als Fluchtgrund anzugeben. Sie befürchten Diskriminierung und Übergriffe durch andere Geflüchtete. Auch die potenzielle Gewalt durch die Behörden und Bevölkerung des Landes, in dem sie Schutz suchen, macht vielen Sorgen.
Obwohl queeren Personen in vielen Ländern der Schutz vor Verfolgung aufgrund ihrer Identität formal anerkannt wird, ist diese Sorge nicht unbegründet. Stand März 2019 kriminalisieren mehr als 60 UN-Mitgliedsstaaten Homosexualität, sechs davon verhängen sogar die Todesstrafe für gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen. Darüber hinaus haben viele Mitgliedstaaten Gesetze eingeführt, die die Meinungsfreiheit in Bezug auf LGBTQI*-Themen einschränken. Selbst in Staaten, in denen Homosexualität kein Verbrechen ist, sind queere Personen oft mit Ausgrenzung, Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt konfrontiert.
LGBTQI*-Asylsuchende und -Geflüchtete sind in den Asylländern oft sozialer Ausgrenzung und Gewalt ausgesetzt. Sowohl von der Aufnahmegesellschaft als auch innerhalb der Gemeinschaft der geflüchteten Personen. Vor allem in Flüchtlingslagern soll die Akzeptanz von LGBTQI*-Personen besonders gering sein. 2021 wies auch der UNHCR darauf hin, dass queere Personen während und nach der Flucht mit „Stigmatisierung, sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, Missbrauch oder mangelndem Schutz durch Sicherheitskräfte“ zu kämpfen haben.
Queere Personen haben somit bis heute oft große Schwierigkeiten, Schutz zu finden.
Unterstützung von LGBTQI*-Geflüchteten
Um queere Geflüchtete zu unterstützen gibt es heute einige Organisationen und Projekte. Weltweit kümmert sich der UNHCR um den Schutz von Personen, die auf der Flucht sind und Asyl suchen. Auch über die besondere Situation queerer Schutzsuchender wird sich dort vermehrt Gedanken gemacht.
Europaweit beschäftigt sich beispielsweise das Projekt „Rainbow Welcome!“ mit der Verbesserung der Aufnahme von LGBTQI*-Geflüchteten in Europa. Sie stellen Informationen zu rechtlichen Verfahren zur Verfügung und schulen LGBTQI*-Unterkünfte und Aufnahmezentren für Geflüchtete. Sie setzen sich zudem für die Sensibilisierung bezüglich der Situation von queeren Personen auf der Flucht ein.
Auch in Deutschland gibt es verschiedene Projekte, die sich der Unterstützung von queeren Schutzsuchenden verschrieben haben. Dazu gehört unter anderem das Projekt „Refugees and Queers. Politische Bildung an der Schnittstelle von LSBTTIQ und Flucht/Migration/Asyl“ der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Zudem gibt es das Förderprogramm „Integration von queeren Geflüchteten und Migrant*innen stärken“ (IQGMS) des LSVD e.V., welches viele regionale, queer-migrantische Projekte und Vereine fördert. Vom LSVD e.V., dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland stammt auch das Projekt „MILES“ das psychosoziale und rechtliche Beratungen für LSBTQI* mit Flucht- und Migrationserfahrungen sowie deren Angehörigen bietet.
Quellen https://taz.de/LGBTIQ-und-Migration/!5964993/ https://www.refworld.org/reference/themreport/unhcr/2015/en/108207 https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2008/en/63725 Fluchtgrund sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität – BUNDESSTIFTUNG MAGNUS HIRSCHFELD (mh-stiftung.de) https://www.queer-refugees.de/leitfaden/ Mole, Richard C. M. (Hg.): Queer Migration and Asylum in Europe, 2021.
Titelbild: Regenbogenflagge, Ludovic Bertron (New York City, USA)