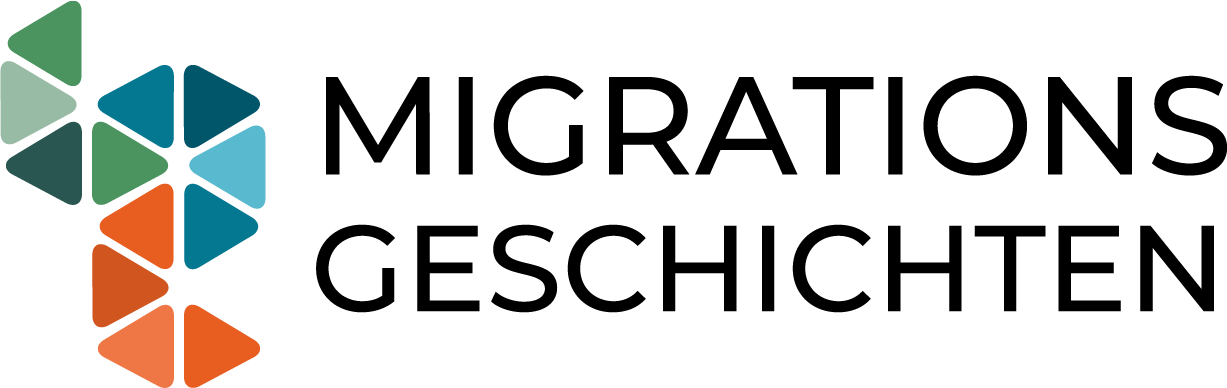Ertekin Özcan lebt seit 1973 in (West-) Berlin. Der promovierte Rechts- und Politikwissenschaftler hat sich seitdem in zahlreichen deutsch-türkischen Verbänden engagiert und ist Gründungsvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD). Vor der deutsch-deutschen Vereinigung war er unter anderem Geschäftsführer des Türkischen Elternvereins in Berlin e.V. Im Interview berichtet er über seine Sicht auf die Vereinigung und die Zeit danach.
Über welche Themen wurde in der türkeistämmigen Community kurz vor dem Mauerfall viel diskutiert?
Themen waren für uns VerbandsvertreterInnen zum Beispiel gerade die doppelte Staatsangehörigkeit und die Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens, das Niederlassungsrecht und ein kommunales Wahlrecht für nichtdeutsche StaatsbürgerInnen. Außerdem die interkulturelle und antirassistische Erziehung und Bildung sowie der mutter- und herkunftssprachliche Unterricht an den Schulen. Des Weiteren forderten wir gleiche Rechte und Behandlung für alle und die Anerkennung der Bundesrepublik als Einwanderungsland. Noch vor dem Mauerfall beschloss die Hamburger Bürgerschaft ein Gesetz über das kommunale Wahlrecht für EinwanderInnen und setzte sich gemeinsam mit Bremen und Berlin auch bundesweit für die Umsetzung ein.
Auf der anderen Seite bereitete der ehemalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble Anfang 1989 eine Neufassung des Ausländergesetzes vor, die das Erlangen eines Visums und des Aufenthalts-rechts erschwerte. Dagegen formierte sich breiter Widerstand.
Darüber hinaus gab es eine große Debatte über die Arbeitszeit. Bis zur Vereinigung hatten ArbeitnehmerInnen 38,5 Stunden Wochenarbeitszeit, Gewerkschaften forderten die 35-Stunden-Woche. Dies wurde auch in der türkeistämmigen Community breit diskutiert.
Wie haben Sie selbst den Mauerfall erlebt?
Der Hitit Verlag hatte am 9. November 1989 für die Vorstellung meines Buches „Türkische Immigrantenorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland“ eine Veranstaltung in Kreuzberg organisiert. Mein erster und mein zweiter Doktorvater wollten das Buch vorstellen. Die Veranstaltung sollte um 19 Uhr beginnen. Wir warteten auf meinen ersten Gutachter Prof. Dr. Jürgen Fijalkowski, aber er kam nicht. Mit etwa 50 Minuten Verspätung erschien er doch und sagte: „Leute, die Mauer ist gefallen. Die Straßen sind voller Menschen und Autos. Ich brauchte 90 Minuten, um mit dem Auto von Zehlendorf hierherzukommen.“
Ich habe den Mauerfall zuerst positiv gesehen und begrüßt. Das Wetter damals war sehr kalt. Die Straßen, Kneipen, Cafés, Restaurants und Geschäfte waren überfüllt wegen der vielen ostdeutschen BesucherInnen. Monatelang öffneten wir als Türkischer Elternverein unsere Räume für sie und boten gegen die Kälte Tee und Kaffee an.
Eine so schnelle Vereinigung Deutschlands hatte ich allerdings nicht erwartet.
Was hat sich dann verändert?
Zum einen wurde die wirtschaftliche Situation für viele schwieriger. Durch den Wegfall der Berlin- und Kindergeldzulage traf die Vereinigung in West-Berlin vor allem sozial schwächere Leute.
Wurde vor der Vereinigung noch über die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich diskutiert, fror man nun die Gehälter ein und fing stattdessen an, über die Verlängerung der Wochenarbeitszeit zu reden. Da EinwanderInnen grundsätzlich im Verhältnis geringere Gehälter erhielten, traf diese Entwicklung sie besonders stark. Zudem galt damals der Paragraf 19 des Arbeitsförderungsgesetzes, nach dem zuerst deutsche StaatsbürgerInnen, dann EG-BürgerInnen, danach erst ImmigrantInnen bei Bewerbungen für eine Arbeitsstelle berücksichtigt wurden. In der neuen Situation wurde es sehr schwierig, als „Ausländer“ einen Job, Ausbildungsplatz oder eine Wohnung zu finden.
Auch große Teile der Mittel für Integrationsmaßnahmen der ImmigrantInnen wurden nun zusammengestrichen. Das Geld wurde nach der Vereinigung für die neuen Bundesländer und die deutschen StaatsbürgerInnen im Osten gebraucht.
Hinzu kamen weitere Rückschläge. So wurde das von Hamburg initiierte kommunale Wahlrecht für EinwanderInnen vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen. Der größte Teil der Ostdeutschen hatte zuvor keine Erfahrungen mit ImmigrantInnen und TürkInnen aus Westdeutschland gemacht. Vorurteile waren verbreitet, etwa, dass „die Ausländer“ ihnen die Arbeit wegnähmen. Es ging nicht nur um allgemeine Ausländerfeindlichkeit. Die Vorbehalte trafen insbesondere TürkInnen als größte Minderheitsgruppe.
Ich erinnere mich genau, dass ich von OstberlinerInnen in dieser Zeit öfter gehört habe, dass wir ImmigrantInnen jetzt nach der Einheit in unsere Heimat zurückgehen müssten. Dies kam sogar von Mitgliedern der SPD, deren Mitglied ich auch bin. Dabei hatten wir seit Jahrzehnten für den Aufbau der Bundesrepublik Deutschland viel geleistet und unseren Lebensmittelpunkt hier aufgebaut.
Unser Eindruck war: Nach der Vereinigung mussten wir in den Diskussionen um Integration, Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wieder ganz von vorn anfangen. Als Türkischer Bund in Berlin e.V., dessen Sprecher ich war, haben wir in Ostberlin Veranstaltungsreihen durchgeführt und versucht, gegenseitige Vorurteile abzubauen.
Doch stattdessen nahmen rassistische und rechtsextreme Gewalttaten zu.
Ja. Viele sagen heute, die Mauer ist uns MigrantInnen auf den Kopf gefallen. Es gibt auch einen Dokumentarfilm, der so heißt. Der DDR-Vertragsarbeiter Amadeu Antonio Kiowa aus Angola wurde in Eberswalde eines der ersten Todesopfer der Wiedervereinigung. Am 30. Oktober 1991 wurde der 19-jährige Mete Ekşi aus der Türkei in Berlin in einer heftigen Auseinandersetzung mit Jugendlichen, die aus dem Ostteil Berlins gekommen waren, durch Baseballschläge schwer verletzt. Er lag 15 Tage im Koma. Am 13. November 1991 starb er.
Nach den Angaben der Amadeo Antonio Stiftung gab es 1990 sieben, 1991 acht und 1992 bereits 27 Todesopfer rassistischer und rechtsextremer Gewalt in Deutschland.
Rassistische und rechtsextreme Angriffe auf Flüchtlingswohnheime setzten sich überwiegend in den ostdeutschen Bundesländern fort, aber zahlreiche schreckliche Überfälle geschahen dann auch in Westdeutschland.
Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen sind bis heute Synonyme für rassistische Gewalt in Deutschland. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl reagierte darauf überhaupt nicht. Er lehnte es ab, vor Ort Präsenz zu zeigen, lehnte Terminvorschläge der ehemaligen Ausländerbeauftragten der Bundesregierung Liselotte Funcke ab. Funcke trat aus Protest dagegen von ihrem Amt zurück.
Die Bundesregierung hat viele Jahre über die wahre Zahl der Todesopfer und Verletzten durch Rassismus und rechte Gewalttaten geschwiegen. Hinzu kam später der verheerende Umgang mit der rechtsterroristischen Anschlag- und Mordserie des sogenannten NSU. Nach den Mordattentaten in Halle und Hanau erhöhte sich die Zahl der Todesopfer nach Wikipedia-Daten seit der Vereinigung auf 209.

Wie reagierte die türkeistämmige Community auf die Entwicklung seit 1990?
Es entstanden mehrere neue Verbände, die gegen Rassismus und für eine bessere Integration etwas beitrugen, etwa am 21. Januar 1990 „Das Aktionsbündnis türkischer Selbsthilfe- und Betroffenenorganisationen in Berlin“ und am 1. Dezember 1991 auf Landesebene der TBB, der Türkische Bund in Berlin e.V. Am 20. März 1994 folgte die TGD, die Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. Im Juni 1993 startete der Türkische Bund in Berlin eine Aktion, in der türkische Geschäfte und Betriebe aus Protest gegen die rassistischen Anschläge für eine Stunde geschlossen waren – auch um zu zeigen, welche Bedeutung TürkInnen für die Stadt haben.
1992 sollte die zweisprachige Erziehung an Berliner Schulen abgeschafft werden. Durch eine Unterschriftenkampagne sowie Protestaktionen des Türkischen Elternvereins und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin wurde die Abschaffung der „zweisprachigen Erziehung“ in 18 Grundschulen zunächst verhindert. Nach und nach wurden die Mittel trotzdem gekürzt und die Anzahl der zweisprachigen Schulen auf inzwischen vier reduziert.
Meine Töchter besuchten das Rückert-Gymnasium, eines der zwei Berliner Gymnasien, in denen Türkisch als zweite Fremdsprache angeboten wurde. Ich war stellvertretender Vorsitzender der Gesamtelternvertretung der Schule. Obwohl wir als türkische Eltern vehement für die Fortsetzung des seit über zehn Jahren praktizierten Türkischangebots eintraten, wurde Türkisch nach dem Abitur meiner Töchter zugunsten eines erweiterten Angebots für Französisch abgeschafft. Als ich in der Gesamtelternvertretung versuchte, für die Beibehaltung des Türkisch-Angebots zu argumentieren und juristisch Widerspruch einzulegen, wurde ich im Laufe der Diskussion und später telefonisch vom Vorsitzenden der Gesamtelternvertretung darauf hingewiesen, dass man „in Deutschland lebe“.
Es wurden zudem finanzielle Kürzungen beschlossen, die sich auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte und SozialpädagogInnen sowie Lehr- und Lernmaterialien für EinwanderInnenkinder auswirkten.
Warum sind diese Erinnerungsperspektiven wichtig?
Alle Generationen müssen aus den schrecklichen Übergriffen und Morden, aber auch aus den anderen Fehlentwicklungen nach der deutsch-deutschen Vereinigung eine Lehre ziehen.
Seit Beginn der Immigration aus Italien sind 65 Jahre vergangen. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund lag am 31. Dezember 2017 bei 19,3 Millionen, davon hatten 10,6 Millionen einen ausländischen Pass. Die Menschen müssen mit ihren verschiedenen Kulturen, Sprachen und Religionen Akzeptanz, Toleranz und Respekt finden können. Die Regierung muss die entsprechenden rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen schaffen, damit ein friedliches Zusammenleben gewährleistet ist. Das gilt auch für die Schulgesetze der Bundesländer und für die Kindertagesstätten.
Dies liegt mir besonders am Herzen: Die Schule sollte ein Ort der Diskussion und Bearbeitung von Konflikten sein, damit zugleich wirksame und konstruktive Formen der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung gelernt werden. Daher muss man vor allem interkulturelle und antirassistische Erziehung und Bildung für alle SchülerInnen einführen. Erziehungs- und Lehrkräfte müssen dementsprechend aus-, fort- und weitergebildet werden. SchülerInnen zumindest der größten Minderheitengruppen sollten außerdem endlich die Möglichkeit haben, neben der deutschen Sprache auch ihre Herkunfts- und Muttersprache als zeugnisrelevantes Fach zu erlernen.