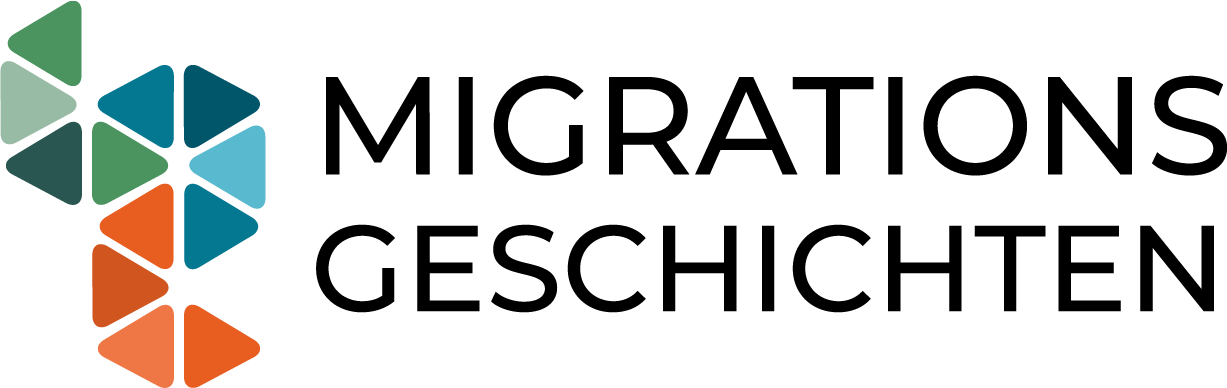In den frühen 1900er Jahren entwickelte sich im Süden der USA eine neue Musikrichtung namens Jazz. Innerhalb weniger Jahrzehnte steckte das „Jazzfieber“ erst die Menschen in Nordamerika an, dann steckte sich auch Europa über die begehrten Schallplatten aus New Orleans, Chicago und Co. an.
Die Geburtsstunde des Jazz
Denkt man Jazz, denkt man: New Orleans. In seinen Anfangstagen wurde der Jazz jedoch auch in Chicago, New York oder Memphis gespielt. Er entwickelte sich aus europäischer Marschmusik und verschiedenen Elementen, die mit afrikanischen Sklav*innen über den Atlantik gekommen war. So ist zum Beispiel die Improvisation, Herzstück jeder Jazzperformance, ein Resultat davon, dass geschriebene Noten in der afrikanischen Musiktradition kaum vorkamen.
Große Namen des Jazz – Ella Fitzgerald, Louis Armstrong oder Joe „King“ Oliver – bewegten die Populärkultur nachhaltig in Literatur, Film und natürlich Musik.
Ihre Innovationen, die neuen, für viele Europäer unbekannten musikalischen Elemente trafen einen Nerv und so dauerte es nicht lange, bis neue Tänze und Melodien über den Atlantik reisten.


Eine regelrechte Tanzmanie
Fast nahtlos wurde das Ende des ersten Weltkrieges durch die Tanzmanie der Nachkriegszeit abgelöst. Jahre der Angst und des Hungers machten sich bemerkbar und besonders die Jugend begann, sich die Erinnerung aus dem Körper zu tanzen. Dabei war die junge Weimarer Republik spät dran, was die neue Musik der Zeit anbelangte: Aufgrund von Wirtschaftssanktionen schafften es die begehrten Schallplatten aus den Staaten nicht über die deutsche Grenze. 1920 war die Berührung mit dem Jazz, der sowohl Modetanz als auch Musikrichtung war, nur über Vermittler wie Eric Borchard, eigentlich Erich, möglich. Er schulte sich und seine Musiker durch das Abhören von Platten.
So kam mit zwei Jahren Verzögerung zum Beispiel der Shimmy in die Republik. Ein Tanz, der Relikte aus den Tanzstilen süd- und US-amerikanischer Sklav*innen beinhaltete. Diese wurden von europäischen Tanzlehrer*innen sogleich in die Formen gepresst, die europäische Sitten zu der Zeit gerade noch so zuließen. Trotzdem wird der*die eine oder andere wohl den Kopf geschüttelt haben, wenn im hippen Berlin in hippen Clubs hippe Feiernde zu „Ausgerechnet Bananen“ (1924, die von Fritz Löhner eingedeutschte Version von Yes! We don’t have Bananas von Frank Silver und Irving Cohn) tanzten.
Ähnlich skandalös mochte der Twostep gewirkt haben, der zwei Jahre später, 1922, über die Grenze kam. Ein Paartanz, der noch heute besonders gern in den Südstaaten der USA aufs Parkett gelegt wird – dort allerdings in Cowboyhut und Jeans zu moderner Pop- und Countrymusik.
Emanzipation im Tanz
Mit dem Charleston ergriff eine weitere Tanzrevolution von der Republik Besitz. Wo früher die Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau den Paartanz dominierte, ist im Charleston keine Spur mehr. Ganz alleine führten junge Frauen die durch die Abwechslung von X- und O-Beinen dominierten Bewegungsabfolgen vor, vollkommen ohne die Notwendigkeit eines männlichen Tanzpartners. Diese „Extase auf dem Tanzparkett“ bestärkte Frauen in ihrem Selbstverständnis als emanzipierte, eigenständige Menschen.
Gleichzeitig allerdings ist der Charleston ein perfektes Beispiel dafür, was europäische Tanzlehrer unter einer angemessenen Bereinigung afroamerikanischer Tänze verstanden. Die typischen „Schleuderbeine“, der „Scheibenwischerfuß“ oder der Kniekicker sind nur Fragmente von dem, was den Charleston ursprünglich ausgemacht hat. Afroamerikanische Tanzelemente wurden kurzerhand entfernt.
Glitzer, Gold und Tango – Die Goldenen Zwanziger
Die Goldenen Zwanziger. Unser Blick auf dieses Jahrzehnt ist durch zahlreiche Filme und Serien wie „Babylon Berlin“ stark geprägt (und romantisiert). Ob es wirklich so wild, glitzerig und golden zuging, wie wenn Liv Lisa Fries oder Lars Eidinger sich durch euphorisierte Massen tanzen?
Naja. Wahrscheinlich wäre zumindest, dass die Frau Fies‘ und Herr Eidingers der echten 20er Jahre Tango tanzten. Zwar erlebte der Tango sein Goldenes Zeitalter erst zwischen 1935 und 1955 – ein bisschen spät für Deutschland – doch schon in der direkten Nachkriegszeit zählte er zu den beliebtesten Tänzen. Dabei setzt sich der Tango, wie wir ihn heute kennen, aus verschiedensten Elementen anderer Tänze zusammen. Großmutter der Tangos war zum Beispiel die Habanera. Sie stammt ursprünglich aus Kuba, wo Sänger*innen wie später ihre Kolleg*innen an der spanischen Mittelmeerküste ihre Sehnsüchte in Musik verwandelten. Auf der anderen Seite der Musikfamilie stand der Candombe. Waren es ursprünglich noch Tanzpantomime der Kreolen und Afrikaner, verlor er bald seine kultischen Aspekte. Man fand ihn später auf Straßenfesten, bevor diese in den USA wegen angeblicher Schlägereien verboten wurden.
Die Tänzer*innen zogen um in die Tanzhallen ihrer Zeit, wo später der Tango geboren wurde.
Ab 1922 konnte man schließlich auch authentische Jazzplatten aus den USA in die Weimarer Republik importieren. Authentisch? Fraglich. Denn was die deutschen Orchester ihrer Zeit spielten, war häufig eher eine Mischung bereits bekannter europäischer Tanzmusik mit einigen „exotischen“ Elementen. Zumal die Platten, mithilfe derer sie sich schulten, eher selten den ambitionierten Jazz junger, afroamerikanischer Musiker*innen abbildeten, welche diesen Musikstil erst hervorgebracht hatten.
Die „weiße Mehrheit“ als Filter der Kunst
In den 1920er Jahren war es in Plattenfirmen gang und gäbe, als Zielgruppe eine weiße Mehrheit anzupeilen. Es war das Ziel, dieser weißen Mehrheit zu gefallen, experimentelle und neuartige Musik zu liefern, jedoch nur in dem Rahmen, in dem es dieser Zielgruppe „geschmackvoll“ erschien.
Denn sogenannte Schwarze Musik, so wie der Jazz, wurde als solche häufig als grundsätzlich minderwertig gegenüber weißer Musik angesehen.
Um dennoch das Potenzial dieser neuen musikalischen Entwicklung auszuschöpfen, verließen Plattenfirmen sich auf weiße Musiker*innen wie Bix Beiderbecke und Chet Baker, um den Jazz auf eine akzeptierte Art zu präsentieren. So wurden ihre Namen bald synonym mit dem Jazz. Währenddessen blieben afroamerikanische Musiker*innen, die diese Musikbewegung erst gegründet hatten, zumeist fern der Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit. Sie hatten es überproportional schwerer, dieselben Level von Berühmtheit und ökonomischem Erfolg zu erreichen wie ihre weißen Kolleg*innen. Daraus erfolgte in der Konsequenz eine Dominanz weißer Musiker*innen, die von dem Jazz und dem Jazzfieber profitierten.
Der Jazz auf seinem Zenit
Mit einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation in Deutschland ab 1924, gewann der Jazz weiter an Popularität. Die Inflation ebbte ab und ließ fruchtbaren Boden zurück. Aus diesem schossen bald Jazz-Orchester und Live-Sendungen wie Pilze. Das Eis brach 1924 die „Deutsche Stunde in Bayern“ (eine Gesellschaft, die das erste Rundfunkprogramm in Bayern bestückte), die erstmals Jazz direkt aus dem Regina-Palastorchester sendete.
Die Jazz-Euphorie war nicht zu bremsen: Jazz symbolisierte Neuanfang, Demokratie und für die Jugend von damals Rebellion gegenüber bekannten Verhältnissen. Komponisten der Klassik hörten Klangfarbe, Synkopen und Bluesharmonie des Jazz und dachten Moderne! Aufbruch!
Besonders kristallisierten sich diese Assoziationen aus der (scheinbaren) Individualität und der Exotisierung bereits bekannter Gute-Laune-Musik heraus. Letzteres erklärt auch die deutschen Texte, in denen von exotischem Obst (Bananen, synonym für heiße Ländern des globalen Südens) oder von Verwandten im Ausland die Rede ist. Ein Beispiel dafür schenkten die Comedian Harmonists 1932 der Welt mit ihrem Song „Mein Onkel Bumba aus Kalumba tanzt nur Rumba“ – in welchem es passenderweise um den beliebten Modetanz Rumba ging, der sich wie ein Fieber ausbreitete.
Rumba – im Übrigen eine Art Cousin des Tango, denn auch Rumba hat seinen Ursprung unter anderem in der afrokubanischen Habanera.
Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – gefiel der Jazz nicht jedem. So war schon das Herz des Jazz, die Improvisation, auf Skepsis gestoßen. In der Weimarer Republik spielte man eigentlich lieber nach Vorgaben.
Ein gewisser Theodor W. Adorno ging sogar so weit, den Jazz als „Gebrauchsmusik der Oberschicht“ zu schimpfen.
Trotzdem gründete Musiker und Jazzliebhaber Bernard Sekles 1928 die weltweit erste Jazzklasse an Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt Main. Sekles musste mächtig stolz auf seine Schüler*innen gewesen sein, deren Jazz es sogar bis in die beliebten Live-Radiosendungen schaffte.

Der Jazz unter den Nationalsozialisten
Bernard Sekles, wie viele aktive Jazzmusiker seiner Zeit, war Jude. 1933 wurde er entlassen, der Jazz, den er so liebte, kurz darauf verboten. Ein Jahr später starb Sekles in einem jüdischen Altersheim in Frankfurt.
Während der Jazz im Rest Europas weiterhin die Populärkultur eroberte, mit Zeitschriften und sogenannten Hot Clubs, wurden die Hürden in Deutschland höher. Zunächst wurde der Jazz aus dem Rundfunk verbannt. 1937 tauchte das Jazzbuch schlechthin von Alfred Baresel auf der Ausstellung „Entartete Kunst“ auf, 1939 wurde die Musik voll und ganz verboten. Zwar wurden diese Verbote lange Zeit umgangen, indem man beispielweise Liedtexte eindeutschte oder von den ganz großen zu eher kleinen, privateren Bühnen umzog. Dennoch war das Hören von Jazz mehr denn je ein Akt der Rebellion.
Die afroamerikanischen Musiker in New Orleans hatten eine Musikrichtung geschaffen, welche Elemente der Kultur von Sklav*innen vereinte und weiterentwickelte. In Vereinigung mit den Tänzen afrikanischen und afrokubanischer Ursprünge hatte er in Windeseile Europa für sich vereinnahmt.
Diese Ursprünge des Jazz waren es auch, die man ab 1933 aus der „deutschen Kultur“ auszuschließen versuchte. Zumal der Individualismus, die Improvisation und Unvorhersehbarkeit des Jazz einfach nicht mit der Gleichschaltung der Nazis zusammenpassen wollten.
1933-1945 war auf keinen Fall das Ende des Jazz in Deutschland – im Gegenteil. In der Bundesrepublik Deutschland ging es danach erst so richtig los. Der Jazz ist von den kleinen auf die großen auf die versteckten Bühnen der Republik gezogen, bevor die Bewegung nach dem zweiten Weltkrieg wieder nach und nach wuchs. Bis heute und vermutlich noch viele weitere Jahrzehnte.
Übrigens: Auch in der DDR etablierte sich eine Jazz-Szene. Neben all den Repressionen im Kunst- und Kulturbereich galt die Jazz-Szene in der DDR bei vielen noch als relativ frei. Dabei mussten sich DDR-Jazzer auf das klassische kulturelle Erbe, auf Brecht, Weill und Volkslieder beziehen, um sich etablieren zu können. Ab Mitte der 70er-Jahre war Jazz nicht mehr Teil der DDR-Underground-Kultur, sondern staatspolitisch gewollt und gefördert.
Quellen:
Black History Month: Jazz and the Evolution of Music | The Bubble
Jazz in Deutschland – Wikipedia
Das Kalenderblatt: 24.05.1925
DIE GESCHICHTE DES JAZZ | Jazz-Geschichte (jazzgeschichte.de)
Titelfoto: Musiker. Foto: © ahkeemhopkins auf Pixabey, gemeinfrei