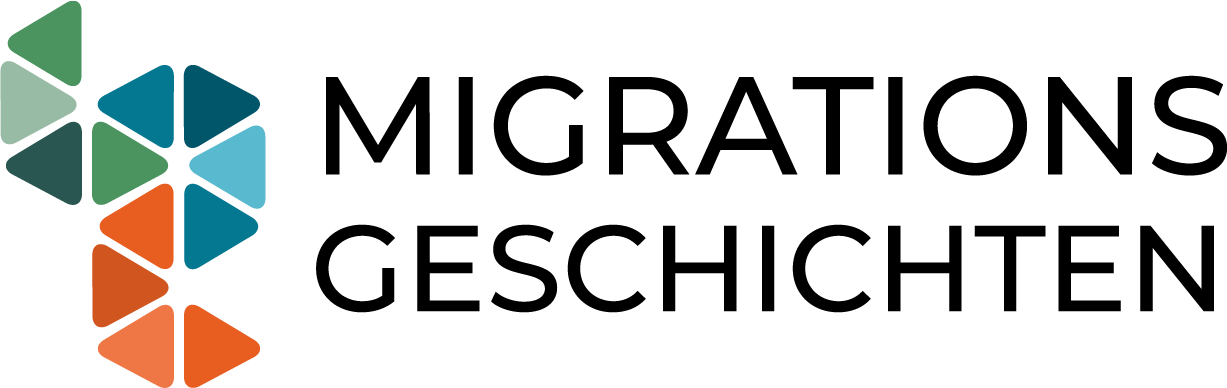In den 1990er und frühen 2000er Jahren emigrierten viele Personen aus der (ehemaligen) Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland. Unter ihnen waren zum einen „Russlanddeutsche (Spät-)Aussiedler*innen“ und ihre Angehörigen. Zum anderen hofften viele der „Jüdischen Kontingentflüchtlinge“ auf eine bessere Zukunft in Deutschland.
Letztere sollten das jüdische Leben in der Bundesrepublik wiederbeleben. Gleichzeitig betrachtete man ihre Aufnahme als einen Akt der „Wiedergutmachung“ der deutschen NS-Verbrechen. Doch welchen Schwierigkeiten, Hindernissen und Problemen standen diese Personen jüdischen Glaubens durch ihre Einwanderung gegenüber?
„Kontingentflüchtlinge“
Die erste demokratisch gewählte Regierung der DDR erkannte 1989 die „Verantwortung für die deutsche Geschichte“ an. In diesem Zuge erlaubte man jüdischen Bürger*innen, die sich von Verfolgung bedroht sahen, die Einreise.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands schuf die Ministerpräsidentenkonferenz hierfür auch eine rechtliche Grundlage: Am 1. Januar 1991 sollten fortan unter Anwendung des „Kontingentsflüchtlingsgesetzes“ in die Bundesrepublik einreisen dürfen und eine Arbeitserlaubnis erhalten.
Lage in der Sowjetunion
Für jüdische Personen war eine solche Einreise aufgrund unterschiedlicher Faktoren interessant. Zum einen war die wirtschaftliche Lage der Sowjetunion desolat: Die „Perestroika“ Michail Gorbatschows hatte das Land in Bedrängnis gebracht. Leere Regale in den Läden waren die Folge.

Zum anderen schwelte der Antisemitismus in der UdSSR. Die Journalistin Erica Zingher spricht davon, dass die schlechte wirtschaftliche Situation ihn noch einmal verschärfte. Jüdische Personen seien als die Schuldigen wahrgenommen worden. Es sei zu Bedrohungen und Übergriffen gekommen.
Wer ist jüdisch– wer darf einreisen?
Der Status als „Verfolgte“ musste bei jüdischen Personen nicht nachgewiesen werden – anders als zum Beispiel bei den vietnamesischen „Boatpeople“. Folglich sollte es ausreichen, wenn jüdische Personen ihren sowjetischen Pass vorlegten.
Dieser Vorgang reichte aufgrund der sowjetischen Gesetzgebung aus: Das Judentum galt in der SU als „Nationalität„. Jüdische Personen hatten somit einen Eintrag in ihren Pass: „nacional’nost: evrej“. Zu Deutsch bedeutete dies: „Nationalität: Hebräer“.
In der Sowjetunion vererbte sich der jüdische Glauben über den Vater. War er jüdisch, galt dies ebenfalls für seine Kinder. Diese Regelung stellte sich allerdings gegen die traditionelle Praxis. Nach der „Halacha“ (rechtliche Auslegung der Tora) sei nur jüdisch, wessen Mutter ebenfalls Jüdin war.
Probleme in den deutschen Gemeinden
Die Anwendung des russischen Rechts brachte jedoch innerhalb der deutschen, jüdischen Gemeinden erhebliche Probleme mit sich. Viele jüdische Kontingentflüchtlinge blieben ausgeschlossen, da die Gemeinden sie als „Vaterjuden“ nicht anerkannten. Sie konnten folglich keine Mitglieder werden.
Des Weiteren hatten sich viele der russischen Juden von ihrer Religion entfremdet. In der Sowjetunion galt eine atheistische Staatsdoktrin. In der Folge übten viele ihren Glauben nicht mehr aus. Aus diesen Gründen fanden letztlich von den 200.000 Einwander*innen nur 85.000 ihren Weg in die Gemeinden. Der Spiegel zitierte den Funktionär einer jüdischen Jugendorganisation hierzu im Jahr 2004 mit den Worten: „Wir haben Juden erwartet, aber es kamen Russen.“
Enttäuschung und Frustration
In ihrem 2020 in der „Taz“ erschienen Artikel „Was wächst auf Beton?“ berichtet die Journalistin Erica Zingher von den Erfahrungen ihrer eigenen Familie. Sie beschreibt, dass die Einreise nach Deutschland mit großen Hoffnungen verbunden gewesen sei. Ihre Eltern, ein Jurist und eine Ärztin, und ihre Großeltern hätten jedoch schnell feststellen müssen, dass diese Träume schwer zu verwirklichen seien.
So seien weder die Ausbildungen ihrer Großeltern, noch das Studium der Eltern von der Bundesrepublik anerkannt worden. Man hielt sich mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser und habe sich so mit einem Leben am Rand der Gesellschaft zufrieden geben müssen. Die Entscheidung sei Zingher zur Folge klar gewesen: Entweder habe man sich an Deutschland anpassen müssen oder sei als „russisch“ geächtet worden.
Ein Feigenblatt für die deutsche Vergangenheit?
Zingher klagt in ihrem Beitrag an, was sie für den eigentlichen Grund der Zuwanderungsförderung hält. Die Bundesrepublik habe mithilfe der jüdischen Kontingentflüchtlinge zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen:
Erstens sollten die Einwander*innen die jüdische Kultur in Deutschland beleben. Die jüdischen Gemeinden umfassten zum Ende der 1980er Jahre gerade einmal 30.000 Mitglieder. Heute verzeichnen sie etwa 105.000 Jüdinnen und Juden. 90% derselbigen stammen ursprünglich aus der Sowjetunion.

Zweitens habe man die deutsche Vergangenheit übertünchen wollen. Mit der Wiedervereinigung schnellten die Zahlen rechtsradikaler Verbrechen in die Höhe. Eine Zuwanderungsförderung von Jüdinnen und Juden aus der UdSSR sei laut Zingher hilfreich gewesen, um das deutsche Image zu verbessern – ohne, dass man sich um die anschließende soziale Situation der Flüchtlinge in Deutschland gesorgt hätte.
Heute
Seit Januar 2005 gilt in Deutschland ein neues Zuwanderungsgesetz. Personen jüdischen Glaubens müssen ihre Einreise nun nach einem „Punktesystem“ beantragen: „nachgewiesene Deutschkenntnisse, nachweisbare positive Integrationsprognose (Arbeitsplatz) und die Zusage, Mitglied in einer jüdischen Gemeinde werden zu können“ entscheiden nun über eine Zukunft in Deutschland.
In der Folge sind die Zuwanderungszahlen stark zurückgegangen. Nur noch etwa 100 jüdische Personen pro Jahr emigrieren in die Bundesrepublik. Wolfgang Schäuble machte im Jahr 2009 allerdings deutlich, dass „[w]enn es von Seiten der jüdischen Gemeinschaft ein entsprechendes Bedürfnis [,die Zuwanderungskriterien für Personen jüdischen Glaubens zu erleichtern,] gibt, wird jede Bundesregierung dazu bereit sein, entsprechende Gespräche […] zu führen.“
Licht und Schatten
Die Erfahrungsberichte ehemaliger jüdischer Kontingentflüchtlinge und ihrer Angehörigen zeigen, welchen Schwierigkeiten die Einwander*innen gegenüber standen – und welche Frustrationen noch bis heute schwelen. Sie sollten deshalb als Beispiele gelten, aus denen wir lernen können.
Themen, wie die soziale Situation von Einwander*innen, müssen folglich ein wichtiger Teil der politischen Agenda bleiben. Entscheidend ist auch, den Dialog zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen nicht abreißen zu lassen. Hierfür ist es wichtig, unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen.
Trotz aller Widrigkeiten gibt es letztlich jedoch auch Zuspruch. So betont der Historiker Dimitri Belkin, dass die Zuwanderung der 1990er Jahre auch einen positiven Einfluss auf die jüdischen Gemeinden in Deutschland gehabt habe. Man habe sich verändern müssen und nur so sei ein „neues deutsches Judentum“ entstanden – ein „Deutsches Judentum 2.0„.
Titelfoto: Viele Personen jüdischen Glaubens zog es in den 1990er Jahren als "Kontingentflüchtlinge" in die Bundesrepublik. Quelle: Pixabay.